
Vorwort
Mein Großvater Wilhelm Max Walter Georg Rahn war während des 2. Weltkrieges der einzige Überlebende seiner U-Boot-Besatzung. Er wurde von den Briten aus dem Mittelmeer gefischt und kam daraufhin bis zum Ende des Krieges in britische Kriegsgefangenschaft, die ihn u.a. auch nach Kanada führte.
Er hat mir seine Aufzeichnungen aus dieser Zeit hinterlassen und ich möchte alle Interessierten gerne an seinen Erlebnissen teilhaben lassen.
„Versenkung“
U 301 lief am 20. Januar 1943 zu seiner ersten Unternehmung im westlichen Mittelmeer aus. Das britische U-Boot Sahib befand sich ebenfalls in diesem Seegebiet. Es war auf dem Rückmarsch von einem Einsatz im Ligurischem Meer mit Kurs auf Algier, wo es stationiert war. Kapitänleutnant Körner ließ am 21. Januar 1943 westlich von Bonifacio auftauchen, um Positionsbestimmungen vornehmen zu können. Bei dieser Gelegenheit wurde U 301 von der Sahib entdeckt. Der britische Kommandant sichtete das deutsche U-Boot um 08.34 Uhr, brachte sein Boot in eine günstige Schussposition und ließ dann eine Salve von sechs Torpedos abfeuern, von denen drei U 301 trafen und versenkten (Lage). Nach Aussage des überlebenden Besatzungsmitglieds Wilhelm Rahn war Kommandant Körner davon überzeugt gewesen, dass es in diesem Seegebiet keine feindlichen U-Boote geben könne.
Der achtzehnjährige Fähnrich zur See Wilhelm Rahn zog sich bei der Versenkung von U 301 eine Verletzung am Kiefer zu, überlebte aber. Er wurde von der Sahib an Bord genommen, in der Koje des Steuermannes einquartiert und pflegte, nachdem er seinen Schock überwunden hatte, unbefangenen Umgang mit den britischen U-Bootmännern. Nachdem die Sahib von einer italienischen Korvette versenkt worden war, kam die britische Besatzung in ein Gefangenenlager in der Nähe von Rom. Der Steuermann und der Chefingenieur wurden für kurze Zeit zur Befragung nach Bremen gebracht, wo ihnen im Namen der Kriegsmarine für die gute Behandlung gedankt wurde, die Wilhelm Rahn an Bord der Sahib zuteilgeworden war.
https://de.wikipedia.org/wiki/U_301 , Aufruf 24.09. 2019, 18:20
********************
Erinnerungen des Fähnrichs zur See
Wilhelm Rahn
21.Januar 1943
Es gibt schöne und weniger schöne Träume. Einen weniger schönen glaubte ich zu träumen. Sah mich im Traum im Wasser einer unruhigen See schwimmen, als mich ein verzweifelter Hilfeschrei plötzlich dem Traum entriss und mir blitzartig bewusst wurde, dass ich wirklich im Wasser lag und nicht in meiner Koje im Unteroffizier-Raum des Unterseebootes U-301.
Eine schreiende Gestalt trieb an mir vorüber, ich sah sie nur wie durch einen Schleier. Die Schreie verstummten, und dann war ich allein in der Weite der See, allein mit der Angst vor dem Ungewissen, vor dem Tod.
Unvermittelt wich diese Angst jedoch dem Selbsterhaltungstrieb, der mich automatisch Dinge tun ließ, von denen mein Überleben im Augenblick abhing.
Da ich keine Schwimmweste trug, kam es darauf an, Ballast abzuwerfen, der mich beim Schwimmen, oder richtiger bei dem Versuch, an der Oberfläche zu bleiben, behinderte.
Von dem schweren Nachtglas, das ich um den Hals trug, konnte ich mich nur befreien, indem ich den Riemen abriss. Dann folgten die Seestiefel, die mir Gott sei Dank ein paar Nummern zu groß waren. Ich konnte sie ohne Schwierigkeiten abstreifen. Anstrengender war es, die Lederjacke loszuwerden; nur gut, dass ich Grund- und Leistungsschein der DLRG an meiner alten Schule gemacht hatte.
Ich handelte, wie ich es gelernt hatte: keine Panik, als ich beim Ausziehen der Jacke unter Wasser geriet. Erleichtert kam ich wieder nach oben, hielt mich mit Schwimmbewegungen über Wasser, wollte solange schwimmen, wie ich konnte, nicht aufgeben. Zwei Stunden war ich schon einmal geschwommen bei der Prüfung für den Totenkopf mit Stern.
So trieb ich im Wasser ohne Hoffnung auf Rettung und hatte Zeit, über meine Lage nachzudenken. Was war geschehen?

U-301 war am Vormittag des 20. Januar 1943 aus dem Stützpunkt der 29. U-Flottille La Spezia/Italien ausgelaufen, um im westlichen Mittelmeer auf Geleitzüge zu operieren, die – von Gibraltar kommend – Algier, Malta oder Alexandria ansteuerten.

Ich gehörte als neunzehnjähriger Fähnrich zur Besatzung dieses Bootes.
In der Nacht hatten wir die Südspitze Korsikas, Kap Bonifacio, passiert, liefen Kurs 216° und mussten uns irgendwo südwestlich des Kaps befunden haben, als es – was? – passierte. Das Kap war mindestens 100sm entfernt.
Ich war um 8.00 Uhr des 21.Januar zusammen mit dem 1.Wachoffizer ( 1 W.O.), der seemännischen Nummer 1, und einem Lord (Mannschaftsdienstgrad ) auf Brückenwache gezogen und hatte den Sektor Backbord voraus (270 – 360°) zu überwachen.
Kurz nach der Ablösung war der Alte( Kommandant ) auf die Brücke gekommen, hatte die Lage gepeilt und uns ermahnt, nicht nur die Kim, sondern auch den Luftraum im Auge zu behalten, da überall mit britischen und amerikanischen Flugzeugen zu rechnen war.
Die See war verhältnismäßig ruhig, Seegang 2 bis 3. Wir liefen 15 sm/h und sollten, über Wasser laufend, Fühlung mit einem Geleitzug aufnehmen, der Gibraltar verlassen und Kurs auf die algerische Küste genommen hatte.
Soweit meine Erinnerung. Dann ein schwarzes leeres Loch. Das Boot war weg. Was hatte sich ereignet? Waren wir auf eine Mine gelaufen? In die Luft geflogen? Alles sprach dafür, dass außer mir und dem Unbekannten, dessen Schreie ich gehört und den ich schemenhaft wahrgenommen hatte, keiner den Untergang des Bootes überlebt hatte.
Waren es Stunden, die ich nun schon auf dem Wasser trieb? Es kam mir wie eine Unendlichkeit vor, ich war der verlassenste Mensch der Welt in diesen Stunden oder Minuten. Außer dem leisen Singen des Windes und der Wellen keine Geräusche, nichts zu sehen aus dem kleinen Blickwinkel, den ich von der Wasseroberfläche aus hatte.
Langsam wurde ich müde, schläfrig, aufgeschreckt nur hin und wieder von Schmerzen am Kopf und am rechten Bein. Ich konnte ja auch nicht ohne Blessuren den Untergang des Bootes überlebt haben. Ich war ruhig geworden, hatte mich bereits in das Unabänderliche gefügt. Dann riss der Faden wieder.
Ich erwachte auf einer Back in einem tunnelförmigen Raum, der mich an unser Boot erinnerte. Gestalten in weißen und blauen Isländern kneteten an mir herum, ich erbrach Wasser und zitterte vor Kälte.
Dann war ich klar bei Bewusstsein und redete die Fremden an, in Englisch.
„Are you British or American? “ Die Antwort: „We are British, you are on board of a British submarine, we picked you up in the very last moment. “ Meine zweite Frage: “Were are my comrades?” Die Antwort: “Sorry, you are the only survivor of your crew.” Da fing ich an zu heulen und jemand schob mir ein Morphium Plättchen in den Mund und ich schlief ein.
Ich weiß nicht, wie lange sie mich schlafen ließen. Das Erwachen geschah langsam und zäh. Ich nahm die Konturen war, die das Innere eines U-Boots ausmachen. Eine Stahlröhre mit ovalen Spanten, im Gegensatz zu dem unserer Boote, die rund waren und größerem Wasserdruck ausgesetzt werden konnten. Ich lag in der Koje eines Raumes, der Schlaf- und Wohnraum der Offiziere zu sein schien. Vor meiner Koje auf einer Back ( Bank ) lag eine Kladde und neugierig, wie ich selbst in meinem elenden Zustand war, langte ich danach und las auf dem Umschlag die Bezeichnung „P 212 Sahib“. Nun wusste ich, wo ich mich befand und wer uns versenkt hatte. Da sich jemand am Scott des Raumes zu schaffen machte, kam ich nicht mehr dazu, einen Blick in das Heft zu werfen.
Einer der Offiziere des Bootes betrat den Raum, sah die Kladde und nahm sie an sich. Ich grinste ihn an und sagte: „ Sahib is a very nice name for a submarine. “ Seine Antwort: “ You clever little bastard, we better watch you.” Er setzte sich mir gegenüber und gab mir bereitwillig Auskunft auf meine Frage, wie es zu unserer Versenkung gekommen war.

https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Sahib
Sahib hatte sich auf einer Feindfahrt im nördlichen Mittelmeer befunden und in Ermangelung besserer Ziele einige Schüsse aus der Bordkanone auf die Eisenbahnlinie an der italienischen Küste abgefeuert. Auf dem Rückmarsch nach Süden hatte sie uns südwestlich von Korsika geortet und sich unbemerkt in eine günstige Angriffsposition manövriert. Aus 800 m Entfernung hatte sie sicherheitshalber einen Fächer abgeschossen. Und getroffen; unser Boot sei praktisch in einer gewaltigen Detonation in Stücke zerrissen worden, die Besatzung hatte keine Chance gehabt. Wie durch ein Wunder seien jedoch zwei Mann der Vernichtung entkommen und anscheinend durch die Detonation aus der Brücke ins Wasser geschleudert worden. Sahib war nach dem Angriff zunächst weggetaucht und hatte sich erst nach einiger Zeit der Versenkungsstelle genähert, um Beweisstücke für ihren Erfolg aufzufischen. Und Oh Wunder, die besten Beweisstücke, zwei Überlebende, trieben immer noch im Wasser. Sahib tauchte auf, um sie aus dem Bach zu fischen. Sie näherten sich zuerst mir, riefen mich an, ich rührte mich nicht und war im Begriff, für immer auf Tiefe zu gehen. Einer ihrer Lords sei dann in den Bach gejumpt und habe mich gerade noch erwischt. In der Zwischenzeit sei der zweite Überlebende leider untergegangen.

Er rettete meinem Großvater das Leben. Beide blieben noch bis zu ihrem Tod in Kontakt
So war ich der einzige Überlebende von U 301. In einigen Büchern über deutsche U-Boot-Verluste, die nach dem Krieg erschienen, gelte ich als tot. Zitat nach dem Gedächtnis: „U 301 unterlag in einem Duell dem britischen U-Boot Sahib am 21.01. 1943; es gab keine Überlebende.“ Was für ein Unsinn. Es gab kein Duell, wir hatten Sahib überhaupt nicht wahrgenommen,“they caught us with our pants down“, sagten die Briten. Die Tatsache, dass wir Sahib nicht ausgemacht hatten, belastet mich auch heute noch. Waren wir, die Brückenwache, Schuld am Tod der Besatzung? Hatten wir getorft, das Sehrohr der Sahib übersehen? Die Torpedos, die von der Sahib abgefeuert wurden, waren E-Torpedos, die keine Blasenbahn hinterlassen. Ein kleiner Trost für mich: Der Angriff der Sahib kam von Steuerbord, und mein Sektor war Backbord voraus. Trotzdem wird der Gedanke einer Mitschuld immer da sein, ist es heute noch, nach 43 Jahren.
Der Bericht des britischen Marineoffiziers hatte mich stark deprimiert. Er bot mir eine Zigarette an. Ich konnte aber nicht rauchen, hatte keine Kraft, an der Zigarette zu ziehen; mein Kopf, in Verbandsstoff eingewickelt, fing wieder an, wahnsinnig zu schmerzen und nach einer neuen Dosis Morphium versank ich wieder in Schlaf, aus dem ich erst Stunden später erwachte. Diesmal war ich nicht allein im Raum. An der Back saß ein britischer Seemann, der sich sogleich nach meinem Befinden erkundigte. Etwas später tauchte ein weiterer Lord mit einem Verbandskasten auf und deutet an, dass er meine Verbände wechseln wolle. Er tat es und die Schmerzen waren unerträglich, als er die laufenden Meter Verbandsstoff, die meinen Kopf einhüllten, abwickelte. Der andere Seemann hatte inzwischen einen Spiegel besorgt und forderte mich auf einen Blick hineinzuwerfen. Was ich sah, trieb mir die Tränen in die Augen: Ein unförmig geschwollener Kopf, dessen Unterkiefer in einem komischen Winkel zur oberen Partie des Gesichts stand, eine klaffende Wunde unter der rechten Kinnseite und dazu blau geschlagene Augen. Mein erster Gedanke war, dass ich für den Reste meines Lebens entstellt herumlaufen müsse und dass die Menschen sich bei meinem Anblick abwenden würden. Die beiden Briten sahen meine Verzweiflung und trösteten mich: „Wait till we make port at Algiers, our medical officers will take good care of you and fix you up. In a couple of weeks you will look better than ever before.“ Ein gut gemeinter Trost, der mich jedoch im Augenblick wenig überzeugte. Nachdem mein Kopf wieder in der schützenden Hülle der Binden verschwunden war, nahmen sie sich noch meinen rechten Fuß vor, der auch einiges abbekommen hatte. Dann erhielt ich wieder das obligatorische Blättchen Morphium und der Schlaf, der gleich darauf einsetzte, ersparte mir weiteres Grübeln über mein künftiges Aussehen.
So vergingen die nächsten Tage in der gewohnten Routine eines Lebens auf einem U-Boot, unterbrochen durch die entsetzlich klingenden und durch Mark und Bein gehenden Töne einer Alarmhupe, gefolgt von Befehlen über die Rundsprechanlage. „Diving stations, diving stations!“ Dieser Befehl brachte Leben ins Boot und an der Veränderung der Bootslage konnte ich feststellen, ob wir tauchten oder auftauchten. Feindberührung gab es dem Anschein nach während der fünf Tage meines Aufenthalts auf der Sahib nicht, denn ich kann mich nicht erinnern, den Befehl „battle stations“ gehört zu haben. Während dieser Zeit lernte ich auch den Kommandanten der Sahib kennen. Commander Bromage, ein ernster Mann in der zweiten Hälfte der Zwanziger. Ich bedankte mich bei ihm für die gute Behandlung und dafür, dass er mich aus dem Wasser hatte fischen lassen. „Never mind, I am sure your people would have done the same.“ – Wie ich später erfuhr, wurde sein Boot etwa vier Monate nach unserer Versenkung von einem italienischen Zerstörer versenkt. Er und die Besatzung überlebten jedoch und verbrachten den Rest des Krieges in Gefangenschaft.
Nach fünf in diesem Sinne erfolglosen Tagen, in denen sich mein Befinden weder verbesserte noch verschlechterte, lief das Boot seinen Stützpunkt Algier an und meine Zeit auf der Sahib ging zuende. Durch das Torpedoluk wurde ich auf einer Trage nach Oberdeck gebracht und konnte bald die malerische Silhouette von Algier ausmachen. Wenig später liefen wir in den Hafen ein und machten längsseits eines U-Boot Tenders, der MS Maidstone fest. Die Offiziere und ein Teil der Besatzung kamen zu mir um mir die Hand zu schütteln und alles Gute zu wünschen. Viele brachten Schokolade und Zigaretten und steckten sie mir unter die Decke. Dann wurde die Trage aufgenommen und unter Seite Pfeifen verließ ich das Boot und meine Retter, die mir versprochen hatten, mich im Hospital zu besuchen. Man schaffte mich in das Bordlazarett der Maidstone und einige Ärzte machten sich über mich her und stellten ihre Diagnose: Ober- und Unterkiefer an mehreren Stellen gebrochen und eine Splitterwunde unter der rechten Kinnseite, daneben weniger schwere Verletzungen am rechten Fuß und an den Händen. Gehirnerschütterung, aber kein Schädelbruch; keine Lebensgefahr, aber ein langwieriger Heilungsprozess.
Eine ältere Krankenschwester mit dem Rangabzeichen eines Hauptmannes, die sich mit den Ärzten eingefunden hatte, schaute mich an nachdem die Ärzte mich verlassen hatten und bemerkte, dass man das Baby nun wohl besser reinigen sollte, denn sehr appetitlich sah ich nach dem Bad in der Dieselölverschmierten See in der Tat nicht aus. Zwei junge Nurses wurden beauftragt, mich wieder in einen menschenähnlichen Zustand zu versetzen und das taten sie. Sie zogen mir erst einmal die ölverschmierten Klamotten aus und machten sich dann daran, das splitternackte Baby zu waschen. Mir war es äußerst peinlich, sie merkten es und grinsten unverschämt. Es war jedoch ein angenehmes Gefühl, endlich wieder sauber zu sein und nicht mehr nach Öl sondern nach guter Lifeboy-Seife zu riechen. Nachdem man mir noch eine Portion wohlschmeckender Fleischbrühe eingeflößt hatte, wurde mir bedeutet, dass ich nun zur weiteren Behandlung in ein Hospital gebracht werden würde. Auf einer Barkasse fuhren wir quer durch den Hafen und wurden an einer Pier von einem Sanka erwartet, der mich nach längerer Fahrt zu einem in den Bergen außerhalb Algiers gelegenen Krankenhaus brachte. Es war das 94th General Hospital, dessen Ärzte und Schwestern ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Mit ihrem ärztlichen Können und liebevoller Anteilnahme gaben sie mir Kraft, weiterzuleben. Ich landete zunächst in einem Krankensaal, der sich offenbar fest in deutscher Hand befand. Mein Bett war sofort von deutschen Landsern umringt, die mich ausfragten und wissen wollten, wer ich sei und woher ich komme. Ein Oberfeldwedel der Luftwaffe machte dann Nägel mit Köpfen und sagte, dass er einen Brief an meine Eltern schicken würde, den ich ihm diktieren solle. Der Brief gelangte etwa drei Monate später in die Hand meiner Eltern, die zu diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt waren, dass ich gefallen sei, denn die Flottille hatte ihnen circa vier Wochen nach unserer Versenkung mitgeteilt, dass das Boot überfällig und mit dem Verlust der gesamten Besatzung zu rechnen sei. Jetzt teilten meine Eltern sofort der Flottille mit, dass man mich gerettet habe, dass es aber außer mir keine Überlebenden gäbe. Die Flottille gab es an die Angehörigen weiter, und meine Eltern erhielten in der Folgezeit Briefe über Briefe von verzweifelt hoffenden Angehörigen, die immer noch an das Wunder glaubten, dass ich nicht der einzige Überlebende sei. Eine vergebliche Hoffnung.
Ich verbrachte die Nacht in dem Krankensaal, musste viel erzählen und hörte mir die Schicksale und Erlebnisse meiner deutschen Mitgefangenen an, bis der Oberfeldwedel Einhalt gebot und sagte, dass ich nun schlafen müsse, da ich am nächsten Morgen auf die Schlachtbank käme, um operiert zu werden. Am frühen Morgen erschien eine Schwester, gab mir eine Spritze und sagte, dass ich mich verabschieden solle, da ich meine Kameraden sicher nicht so bald wiedersehen würde. Ich sah keinen von ihnen wieder. Man schob mich in den Operationssaal und eingeschläfert durch eine Äthernarkose ließ ich die erste von drei Operationen über mich ergehen. Ich erwachte in einem Bett in einem großen Raum. Neben meinem Bett, das das letzte in einer langen Reihe war, nahm ich einen britischen Soldaten mit Stahlhelm und Gewehr wahr. War er zu meinem Schutz oder zu meiner Bewachung da? Als er sah, dass ich das Bewusstsein wiederlangte und mit heftigem Brechreiz zu kämpfen hatte, rief er laut nach einer Schwester, die gerade rechtzeitig kam, um mit einer Nierenschale das aufzufangen, was ich unbedingt loswerden wollte. Danach fühlte ich mich besser und konnte meine Umgebung ausmachen, soweit das in liegendem Zustand möglich war. Mein Bettnachbar richtete sich auf, grinste mich an und sagte: „I am Master Sergeant Sam Couch, US Army Air Force from Rome in Georgia, and what`s your name, kid?“ Ich sagte es ihm und er erzählte mir, dass sein Bomber von einem deutschen Jäger abgeschossen worden sei gleich nach dem Start vom eigenen Feldflughafen und dass er das Glück gehabt habe, sich mit dem Fallschirm retten zu können. Leider hätte ihm der Kraut den halben Unterkiefer abgeschossen und er müsse seine Zigaretten nun durch die Nase inhalieren. Auf die Wache, die neben meinem Bett stand, angesprochen meinte er, dass ich eben ein so gefährlicher submariner sei, dass man kein Risiko eingehe. „Stupid Limeys,“ war sein Schlusskommentar.
Sam erzählte mir, dass in unserem Ward nur Verwundete mit Kopfverletzungen lägen und dass wir „real international“ seien. Wir hatten vorwiegend Amerikaner und Briten, aber auch Franzosen, Norweger, Holländer und Inder, sowie Neuseeländer und Australier. Soweit sie schon die Betten verlassen konnten, kamen sie alle an meine Koje um sich bekannt zu machen, und jeder brachte eine Kleinigkeit mit: Zigaretten, Schokolade, Candy, Seife. Was Kriege doch für ein Wahnsinn sind. Gerade noch wären wir uns an die Gurgel gegangen und hätten versucht, einander umzubringen; nun waren wir Leidensgenossen ohne Ressentiments gegen den anderen. Aber das ist wohl die vielzitierte und oft auch geschmähte „band of brothers“ der Frontsoldaten.
Nach zwei weiteren Operationen, in denen meine Gesicht wieder in die richtige Lage gebracht wurde, machte mein Heilungsprozess langsam Fortschritte. Nach der letzten Operation hatte man mir Schienen aus Metall über die Zähne der beiden Kiefer geschoben und diese mit Draht festgebunden, sodass ich Ober- und Unterkiefer nicht bewegen konnte und die Brüche zusammenheilen konnten. Durch die Wunde unter dem Kinn hatte man einen Schlauch in die Mundhöhle geführt und eine Drainage hergestellt. Der ganze Dreck wurde in einen dicken Verband an meine Brust geleitet und der Duft, der mir in die Nase stieg, war nicht lieblich. Aber die Nurses waren hilfsbereit und wechselten die „Müllgrube“ häufig.
Zwischendurch erhielt ich oft Besuch. Zuerst kamen Besatzungsangehörige der Sahib, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen, dann die Himmelslotsen beider Konfessionen. Erfahrene Verwundete rieten mir, jeweils die Konfession des besuchenden Geistlichen anzunehmen, um diesen in größere Geberlaune zu versetzen. Das brachte ich jedoch nicht übers Herz und so musste ich mir von meinen Genossen den Vorwurf der Dämlichkeit gefallen lassen. Schließlich wurde hoher Besuch angekündigt, der im Vorfeld einen wahren Putzrausch auslöste. Wir machten unsere Witze darüber, beschwerten uns aber nicht über den außerplanmäßigen Wäschewechsel. Schließlich blitzte alles vor Sauberkeit, die Betten waren ausgerichtet und standen auf milimetergenauen Abständen und Ward Number One war bereit zum Empfang des US Generals Mark Clark, dem Oberbefehlshaber der in Algerien und Tunesien kämpfenden amerikanischen Streitkräfte. Dann kam er. Imposante Erscheinung, lässig und von einer Unkompliziertheit, die bei seinen deutschen Kollegen selten oder gar nicht anzutreffen war. Da mein Bett das Erste in der Reihe war, war ich auch der Erste, dem er sich zuwandte. Nachdem ihn der Chefarzt unterrichtet hatte, wen er vor sich habe, unterhielt er sich für eine Weile mit mir über meine Herkunft, mein Zuhause, fragte mich, ob die Behandlung ok sei und wünschte mir baldige Genesung und alles Gute für die Zukunft.
Meine Mahlzeiten oder besser die Einnahme derselben waren immer eine schwierige und langwierige Prozedur. Es erwies sich als nützlich, dass mir bei der Detonation meines Bootes auch einige Zähne ausgeschlagen worden waren: so bildete die Zahnlücke in Verbindung mit einer Öffnung in der unteren Schiene eine Futterluke. Durch sie wurde der Hals einer Schnabeltasse eingeführt und flüssige Nahrung wie Fleisch- und Hühnerbrühe, Kakao oder Milch waren kein größeres Problem. Anders jedoch die feste Nahrung, die in der Hauptsache oder fast ausschließlich aus Weißbrot mit Butter oder Fleisch- oder Fischpastete bestand. Das alles drehte ich erst zu passenden Kügelchen, schob es dann durch die Luke und zerteilte es mit der Zunge, bevor ich es herunterschluckte.
Inzwischen durfte ich mich auch ab und zu erheben, um die Toilette aufzusuchen. Der Posten marschierte stramm mit, bis ihm das Gelächter der übrigen Ward-Insassen auf die Nerven ging und er mich schweren Herzens allein gehen ließ. Das WC, das an den Waschraum angrenzte, hätte auch gar nicht zur Flucht genutzt werden können: Es gab keine Tür nach draußen und in meinem Zustand verschwendete ich auch keinen Gedanken an ein „escapen“.
Der Waschraum war der Ort, an dem meist abends kleine Trinkgelage stattfanden. Einige aus unserem Ward durften schon an Land gehen und brachten immer einige Flaschen guten algerischen Weins mit, den dann zum größten Teil die Nichtbettlägerigen im Waschraum verkonsumierten. Ich wurde von Anfang an aufgefordert, mitzumachen, und mit meiner Schnabeltasse und dem Posten bewaffnet nahm ich teil. Das Gelage endete meist mit dem gemeinsamen Lied „Underneath the lamplight by the barrack square, darling I remember the way you used to care“, deutsch „Lilli Marlen“, selbst die Schwestern kamen und sangen mit.
Dann kam der langersehnte Tag, an dem der Draht, der die beiden Schienen über meinen Kiefern verband, entfernt wurde. Eine einfache Sache, schwieriger war es jedoch, den Gummischlauch, der durch die Wunde am Kinn in die Mundhöhle führte, zu entfernen. Zwei junge Schwestern bemühten sich, ihn herauszuziehen. Da sie mir jedoch nicht wehtun wollten und zu vorsichtig zu Werke gingen, wollte es ihnen nicht gelingen. Da erschien die Principal Martron, eine Walküre an Gestalt, sah sich die Versuche an, sagte „rubbish“, nahm eine Sicherheitsnadel, steckte sie durch den Schlauch, nahm sie zwischen zwei Finger und riss den Schlauch mit einem Ruck aus seiner Verankerung. „That`s the way to do it, he ought to be a tough guy, and it will not kill him. Das einzige, was ich halb wahnsinnig vor Schmerz herausbringen konnte, war „Thank you, Mam.“ Der erste Versuch, den Unterkiefer zu bewegen, gelang nur mühsam. Dann kam die Stationsschwester und sagte, dass die „Lösung der Fesseln“ gefeiert werden müsse und ich mir ein Dinner nach Wahl bestellen könne. Da ich ausgehungert nach Fleisch war, bestellte ich mir ein saftiges Steak, was mir auch prompt gebracht wurde. Aber es war mir leider nicht möglich, es zu zerbeißen. Die Kiefer hatten eine zu lange Ruhepause gehabt und versagten ihren Dienst. So war ich gezwungen, das Steak in ganz kleine Stück zu schneiden und das Fleisch einfach herunterzuschlucken. Mit dem Nachtisch, Eis mit Pfirsich, ging es besser und ich fühlte mich nach dem Mahl im siebten Himmel.
An einem der nächsten Tage ereignete sich etwas, das ziemlichen Wirbel verursachte. Der Posten neben meinem Bett kippte um. Er fiel zu Boden und sein Gewehr lag auf der Diele. Als gut erzogener Soldat, der ich war, konnte ich keine Waffe auf dem Boden liegen sehen, stieg aus meiner Koje und hob den Karabiner auf. In diesem Augenblick kam eine Schwester in den Ward, sah mich mit der Waffe und schrie entsetzt „the German got a gun!“ und rannte unter dem dröhnenden Gelächter der anderen aus dem Saal. Ich lehnte die Flinte an die Wand und stieg wieder in mein Bett. Dann kam die Schwester mit einigen männlichen „orderlies“ zurück und der Zwischenfall endete damit, dass man den ohnmächtig gewordenen Posten wieder zu sich brachte und ablösen ließ.
Am Tag nach diesem Ereignis kam ein zweiter Deutscher auf unsere Station, ein Unteroffizier von der Infanterie, der bei einem Nachtangriff der Neuseeländer auf seine Stellung verwundet in Gefangenschaft geraten war. Er war schrecklich zugerichtet mit zwei Bajonettstichen in den Unterleib und einem Kolbenschlag, der den Unterkiefer zertrümmert hatte. Ich ging sofort an sein Bett, er wurde aber noch gar nicht gewahr, dass er von einem Deutschen angesprochen wurde. Es sah bös für ihn aus, aber die wirklich guten britischen Ärzte brachten ihn bald über den Berg und ich saß den größten Teil meiner Zeit an seinem Bett, unterhielt mich mit ihm, schrieb einen Brief an seine Eltern und war selbst froh, nicht mehr der einzige Deutsche in unserem Krankensaal zu sein.
So vergingen die Tage, und eines Morgens erfuhr ich, dass die Deutschen am Kasserim Pass eine Offensive gestartet hatten, die anscheinend dem Gegner einiges Kopfzerbrechen bereitete. Frech wie ich war ging ich in unserem Ward herum und erzählte allen, dass meine Kameraden in den nächsten Tagen das General Hospital 94 übernehmen würden und dass ich mich für das Wohlergehen meiner Kumpel verbürge. Es kam aber alles anders. Nach Anfangserfolgen blieb die Offensive stecken, es kamen nicht die Deutschen aber ein großer Strom verwundeter Amerikaner. Da das Hospital diesem Ansturm von Schwerverwundeten nicht gewachsen war, wurden alle nicht mehr bettlägerigen aus den festen Unterkünften in Zelte verlegt und ich wechselte nach dem Abschied von meinem deutschen Kameraden in ein Gefangenenlazarett in Zelten in unmittelbarer Nähe des 94. General Hospital. Ein neuer Abschnitt in meinem Dasein als Kriegsgefangener begann.
Ich hatte natürlich nicht nur Abschied von meinem deutschen Kameraden genommen sondern auch von allen anderen auf der Station. Von Bett zu Bett ging ich, schüttelte viele Hände und wir wünschten uns alles Gute für die Zukunft. Anschriften wurden ausgetauscht, Einladungen für die Zeit nach dem „bloody war“. Die, welche nicht mehr an die Betten gebunden waren und auch ihre Sachen für die Verlegung in Zelte packen mussten, begleiteten mich bis vor das Hospital und sangen „for he is a jolly good fellow“; mir kamen bald die Tränen. Und es blieb ein Abschied für immer: bis heute habe ich keinen meiner Leidensgenossen aus Beni Mossous, dem ehemaligen Waisenhaus, in dem sich das Hospital einquartiert hatte, wiedergetroffen.
Nun marschierte ich mit meiner Eskorte zu einem Sanka, der uns ein paar Meter bis zum Tor eines von hohem Stacheldrahtzaun umgebenen Zeltlagers, dem Gefangenenlazarett, brachte. Als das Tor hinter mir zuschlug, begann meine eigentliche Gefangenschaft oder besser, mir wurde zum ersten Mal deutlich, dass ich ein POW, ein Prisoner of War, war. Beim Anblick des Tores musste ich an Dantes Ausspruch denken: „Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnungen fahren.“ (Zitate sind Glückssache, richtig muss es heißen „Lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung schwinden!“ – „Lasciate ogni speranza, voi ch`entrate!“ (Hölle 3,9))
Nach den üblichen administrativen Formalitäten, die sich in der ganzen Welt gleichen, landete ich schließlich in einem großen Zelt mit Platz für ein halbes Hundert Betten, aber nur drei Insassen. Die Oberschwester (Principal Matron), die mich zusammen mit einer anderen Schwester begleitete, stellte mich den dreien vor, nachdem sie mir meine Koje angewiesen hatte. Zwei von ihnen waren Angehörige der Luftwaffe. Oberleutnant Warmbold war Torpedoflieger und beim Angriff auf den Hafen von Algier abgeschossen worden; der andere, dessen Namen ich nicht mehr erinnere, war Jagdflieger und hatte bei einem Abschuss durch amerikanische Jäger schwere Brandverletzungen an den Beinen erlitten, ehe er mit dem Fallschirm abspringen konnte. Er hatte beim Flug kurze Khakihosen getragen, was den Flammen direkten Zugang zu seiner Haut bot. Der dritte im Bunde war Heeresoffizier, ein junger Leutnant, der bei einem Spähtrupp von den Amerikanern gefasst worden war, nachdem ihn seine Kameraden schwer verwundet haben zurücklassen müssen. Alle drei zeigten sich hocherfreut, endlich den vierten Mann zum Doppelkopf gefunden zu haben, ein Spiel, mit dem wir uns manche afrikanische Nacht um die Ohren schlugen.
Die Zeit verging. Ich trug immer noch die Schienen im Mund, sie störten mich kaum mehr, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mit fortschreitendem Heilungsprozess erwachten natürlich auch andere Gefühle. Das stärkste war der Drang nach Freiheit, und zusammen mit Gleichgesinnten erkundeten wir alle Möglichkeiten, aus dem Lazarett herauszukommen und die deutschen Linien zu erreichen. Ein Wahnsinn bei unserer Verfassung und der miserablen Lage, in der sich die „Panzerarmee Afrika“ befand. Schließlich entdeckten wir, was wir suchten, ein Abflussrohr, das unter dem Zaun hindurchführte und uns groß genug erschien, um hindurchzukriechen. Wir stellten auch fest, dass die beiden Posten, die am Zaun entlang das Lager umrundeten, sich an zwei Stellen trafen, die weit genug von diesem Abflussrohr entfernt waren, um uns ungesehen das Hindernis passieren zu lassen. Hinzu kam, wie unsere Beobachtungen ergaben, dass sie bei jedem Treffen ein kleines Rees an Backbord abhielten, dass uns zusätzliche Zeit für unser Vorhaben bescheren würde. Dann kam die Nacht der Nächte. Sie war dunkel genug für unser Vorhaben. Mit etwas Proviant versehen, den wir von einem der deutschen Köche in der Lazarettküche bekommen hatten, schlichen wir zum Zaun und der erste zwängte sich in das Rohr. Aber Scheiße, es gelang ihm nicht, hindurchzukriechen; er blieb stecken und unter leisen Verwünschungen gelang es uns nach einigen Anstrengungen, ihn an den Beinen wieder herauszuziehen. Inzwischen war es höchste Zeit für uns, zu verduften, denn wir konnten bereits die Schritte und das Pfeifen eines Postens hören, der sich dem Tatort näherte. Schnell schlüpften wir in das nächstgelegene Zelt, und das war das Ende unseres ersten Fluchtversuchs.
Wir hatten nun Zeit, über andere Wege, dem Lager zu entkommen, nachzudenken. Angriffe der deutschen Luftwaffe auf den Hafen von Algier, die ausschließlich nachts erfolgten, riefen uns ins Gedächtnis, dass der Krieg noch nicht zuende war (er sollte noch mehr als zwei Jahre dauern). Und es war ein beeindruckendes Feuerwerk, das sich über dem verdunkelten Algier abspielte. Die Flak-Konzentration um Algier soll eine der größten des Krieges gewesen sein und wir hatten quasi einen Logenplatz, um das Spiel der Scheinwerfer, die Detonation der Geschosse der schweren und die Leuchtspur der mittleren und leichten Flak zu verfolgen. Arme Hunde, dachten wir, die in dieses Inferno hineinfliegen mußten. Am Morgen darauf kam dann gewöhnlich der eine oder andere Flieger, der abgeschossen überlebt hatte, in unser Lazarett und berichtete uns über den Angriff und auch darüber, wie es an der gesamten Front aussah, sofern er dazu in der Lage war. Es sah überall nicht rosig aus. Stalingrad gefallen, die „Panzerarmee Afrika“ in einer aussichtslosen Lage und die Heimat unter ständigen schweren Luftangriffen. Indoktriniert wie wir alle waren glaubte keiner zu dieser Zeit, dass wir den Zenit überschritten hatten und auf dem Weg in die totale Niederlage waren. Bezeichnend für unseren Geisteszustand war ein Zwischenfall, an den ich mich heute mit Beschämung erinnere. Die Principal Matron erzählte uns eines Morgens, dass deutsche U-Boote aus einem nach Algier laufenden britischen Geleitzug mehrere Schiffe versenkt hätten und dass dabei auch Schwestern, die für das Hospital bestimmt waren, den Tod gefunden hätten. Meine erste Reaktion war die Bemerkung: „Es können gar nicht genug Schiffe versenkt werden!“ Die Principal Matron, die dem Alter nach meine Mutter hätte sein können, sah mich lange an und sagte dann mit Verachtung in der Stimme: „Cruel little Nazi, Willi.“ War es Zufall oder eine Reaktion auf diesen Vorfall, dass mir am nächsten Morgen von einem Arzt eröffnet wurde, ich sei nun so weit genesen, dass kein Grund mehr vorläge, mich im Lazarett zu behalten?“ Nachdem er mir die Schiene aus dem Mund entfernt hatte, wurde mir bedeutet, meine sieben Sachen zu packen und ich erhielt die Dinge zurück, die ich bei meiner Rettung getragen hatte. Meine Lederhose und die Jacke des U-Boot Päckchens, dazu ein paar Tropenstiefel des Afrikakorps mit langen Schäften. So angetan wurde ich von einem Posten abgeholt und zu einem LKW gebracht, der vor dem Tor wartete. Darauf saßen drei weitere Posten, was mich zu einem unverschämten Grinsen veranlasste. Ab ging die Post und dem Stand von Sonne und Uhrzeit konnte ich entnehmen, dass sie nach Süden ging. Wir hielten kurz an einem kleinen Bahnhof und zu meiner großen Freude nahmen wir dort einen deutschen Oberleutnant auf. Zu zweit fuhren wir nun einem unbekannten Ziel entgegen und erreichten gegen Mittag ein großes Gefangenenlager, ein Mannschaftslager, in dem wir jedoch nur Rast machten um zu essen. Ich erinnere mich noch gut an den deutschen Lagerführer, Oberfeldwedel Siegfried Mohr, ein Hüne von Gestalt, den ich Jahre später im Polizeisportverein Hannover wiedertreffen sollte. Nach kurzem Aufenthalt ging es dann weiter nach Süden, schließlich landeten wir in einer kleinen verträumten französischen Kolonialstadt, Boufarik, an der Straße von Algier nach Blida. Am Rande der Stadt befand sich ein Sportplatz, den man als provisorisches Gefangenenlager zweckentfremdet hatte. Gut hundert bis hundertfünfzig Dreimannzelte standen auf dem Fußballfeld, vor dem Doppelzaun die Unterkünfte der Wachmannschaft. Ehe wir in das Lager geführt wurden, geschah die obligatorische Filzung auf Gegenstände, die für eine Flucht von Nutzen sein könnten. Neben einigen Auszügen aus dem Kornett von Rilke, die ich aus dem Gedächtnis aufgeschrieben hatte, fand der filzende Sergeant auch den Anfang des Hamlet-Monologs „to be or not to be, that`s the question, wether it`s nobler in the mind to suffer the slings and arrows outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them!“ Der Sergeant sah mich an, hielt mir den Zettel vors Gesicht und knurrte: „Bloody Goebbels!“ Grinsend erwiderte ich: „Wrong, Shakespeare!“ Sein verdutztes Gesicht und das Gelächter des Captains, der die Filzung überwachte, sind mir in angenehmer Erinnerung.
Endlich war die Prozedur vorüber und wir folgten dem Captain ins Lager, wo er uns das erste Zelt in einer Reihe als Unterkunft anwies. Da wir anscheinend die einzigen Insassen des Lagers waren, spotteten wir, dass der Aufwand für zwei POWs doch ein bisschen übertrieben sei; eine ganze Kompanie für die Überwachung von zwei Hanseln? Und: sie würden das Lager nie füllen können! Seine Antwort: „Wait and see!“
Er sollte Recht behalten. Einige Wochen später, nach der Kapitulation der deutschen und italienischen Streitkräfte in Afrika war das Lager bis zum letzten Zeltplatz ausgebucht.
Das erlebte ich jedoch nicht mehr, da man mich inzwischen auf die Reise in das United Kingdom geschickt hatte. Aber so weit war es noch nicht. Zunächst waren der Oberleutnant und ich wirklich die einzigen Insassen des Camps. Wir vertrieben uns die Zeit mit „66“. Zu diesem Zweck benutzten wir zwei Sitzbadewannen, die wir mit kaltem Wasser füllten, denn die letzten Apriltage waren schon mächtig heiß, setzten uns hinein, legten ein Brett über unsere Wannen und hatten so den nötigen Kartentisch.
Zweimal täglich wurde unsere Anwesenheit offiziell von den Bewachern festgestellt. „Roll and Call“ hieß der Spaß. Wir mussten uns vor unserem Zelt aufstellen und wurden gezählt. Eins, zwei. „Zählen können sie, das muss ihnen der Neid lassen.“, murmelte der Oberleutnant. Dann beschlossen wir, unseren Bewachern bei Morgen-Roll-Call einen Streich zu spielen. Wir traten nicht vor unserem Zelt an sondern versteckten uns in einem der zahlreichen anderen Zelte und überließen es den Tommys, uns ausfindig zu machen. Sie fanden dies aber nicht so komisch und es wurde uns für den Wiederholungsfall eine Kürzung der Rationen angedroht.
Bald darauf bekamen wir Verstärkung. Zunächst tauchten zwei junge Leutnants auf, Angehörige der berühmt-berüchtigten Division „Brandenburg“. Das war ein Verband, den man am besten mit den Kommandos der britischen Royal Marines vergleichen konnte. Er bestand aus ausgesuchten Freiwilligen, die zumeist Aufträge hinter den feindlichen Linien auszuführen hatten. So auch die beiden Neuankömmlinge. Sie waren mit einem Lastensegler hinter der Front abgesetzt worden und sollten mit ihrer kleinen Einheit Brücken in die Luft sprengen und allgemeine Verwirrung im Hinterland stiften. Dabei waren sie jedoch bald ausgemacht und nach einer gnadenlosen Jagd fast aufgerieben worden. Ein paar ihrer Landser waren mit ihnen in Gefangenschaft geraten.
Nach und nach vergrößerte sich die Zahl der deutschen gefangenen Offiziere in unserem Lager, und als wir vierzehn Mann stark waren, hieß es für die beiden Brandenburger und mich, Abschied von Afrika zu nehmen. Ich war froh, denn die glühende Hitze bei Tag und die eiskalten Nächte waren nicht dazu angetan, das Land zu lieben. Außerdem verfolgte mich oft nachts ein Alptraum. Ich glaubte zu schlafen, hörte aber, wie sich meine beiden Zeitgenossen unterhielten. Dabei konnte ich mich jedoch nicht rühren, sah nur manchmal eine Gestalt mit einem Messer ins Zelt schleichen und meinte dann, dieses Messer an meiner Kehle zu spüren. Ein anderes Mal war ich nur bewegungsunfähig und voll panischer Angst, mich nie wieder rühren zu können. Ich muss dann gestöhnt oder geschrien haben, denn meine Kameraden stießen mich an und brachten mich so wieder in die Wirklichkeit zurück. Ich berichtete ihnen von diesen Traumzuständen und sie weckten mich danach immer schnell auf, wenn sie merkten, dass ich mich quälte. Ein Arzt sagte mir später, dass diese Alpträume das Resultat der von mir verdrängten Erlebnisse, des Todes meiner Besatzung und eines latenten Schuldgefühls seien. Sie verfolgen mich auch heute noch, obwohl die zeitlichen Zwischenräume größer geworden sind.
Die Brandenburger und ich packten also unsere Sachen, bestiegen einen LKW mit der obligatorischen Wache aus einem Offizier und vier Mann und diesmal ging die Fahrt ab in den Norden. Auf dem Weg nach Algier, dem Ziel unserer Fahrt, wurden wir Zeugen der ungeheuren materiellen Überlegenheit der Alliierten. Kilometerweit entlang der Straße reihte sich Munitionsstapel an Munitionsstapel, abgelöst von hunderten von Panzern, Geschützen, LKWs und Jeeps. Wir wurden immer stiller, die Präsentation der Industriemacht USA und ihres Leistungsvermögens machte uns deutlich, worauf sich unsere glorreiche Führung eingelassen hatte, als sie sich verblendet von Anfangserfolgen der ersten Kriegsjahre größenwahnsinnig mit der Sowjetunion und dann auch noch mit den USA angelegt hatte. Trotzdem glaubten wir noch an den Endsieg. Eine neue Sommeroffensive gegen die Sowjets und die Vernichtung der Anglo-Amerikaner, sollten sie es wagen, in Frankreich zu landen, würden dem Krieg die Wende geben. Arme Irre, die wir immer noch waren. Nicht auszumalen, wie es in der Welt heute aussehen würde, hätten wir tatsächlich den Krieg gewonnen. So erreichten wir schließlich den Hafen von Algier, in dem sich Frachter und Passagierdampfer drängten. Der Führer unserer Eskorte übergab uns an Bord eines Fahrgastschiffes an eine neue Eskorte, die – mit Sten Guns bewaffnet – unschwer als Royal Marine Commandos zu erkennen waren. Der Empfang war außergewöhnlich freundlich. Es wurden uns zwei Kammern an Oberdeck zugewiesen, die beiden Leutnants bezogen die eine, ich solo die andere. Endlich wieder fließendes Wasser und eine richtige Koje! Ich war noch beim Einrichten, als wir Besuch bekamen. Drei Offiziere der Royal Marines klönten mit uns, brachten Zigaretten und fragten, ob wir einen Wunsch hätten. Übereinstimmend sagten wir, dass wir gern baden oder duschen würden. Unserer Bitte wurde entsprochen, und ein paar Minuten später lag ich wohlig ausgestreckt in einer richtigen Badewanne mit heißem Wasser. Es war zwar ein ungewöhnliches Bad, denn in der Tür des Badezimmers stand ein Posten mit Sten Gun; der störte mich nicht. Strahlend sauber wurden wir dann zum Essen abgeholt. Wir trauten unseren Augen nicht; man führte uns in die Offiziersmesse, wo wir einen separaten Tisch zugewiesen erhielten.
Ein Lieutenant Colonel kam an unseren Tisch und stellte sich als Kommandeur des an Bord befindlichen Kommandos der Royal Marines vor, das von Afrika zurück nach England verlegt wurde, ein Zeichen, dass der Krieg in Nordafrika seinem Ende zuging. Der Colonel fragte ob alles allright sei und wünschte uns und sich eine gute Überfahrt nach England. Wir ließen uns das Essen schmecken und genossen die Bedienung durch indische Stewards. Dann zogen wir uns – nach Kaffee und einer guten englischen Zigarette – in unsere Gemächer zurück und spielten einen zünftigen Skat.
Gegen Abend kam Bewegung ins Schiff und alles deutete auf Vorbereitungen zum Auslaufen hin. Wir erhielten wieder Besuch und man brachte Blenden an den Bullyeyes an und bedeutete uns, dass wir zunächst in unseren Kammern eingeschlossen würden bis wir den Hafen verlassen hätten. Bald nahmen die Schiffsmaschinen ihre Arbeit auf und wir hörten die Kommandos, die ein Ablegemanöver begleiteten. An den Bewegungen des Schiffes merkte man, dass wir den Hafen verlassen und die offene See erreicht hatten. Nach geraumer Zeit wurden unsere Türen geöffnet und man geleitete uns wieder in die Offiziersmesse zum Abendbrot. Waren wir einmal in der Messe, verzog sich der Posten diskret. Nach dem Abendessen saß ich noch eine Weile in der Kammer des Leutnants zum Klönen. Dann kam die erste Nacht an Bord nach fast vier Monaten und ich schlief tief und fest, obwohl ich den Gedanken an meine Kameraden von der 29. U-Flottille, die dort draußen in der Nacht vielleicht irgendwo auf uns lauerten, nicht verdrängen konnte. Aber ich setzte auf die alte Seemannsweisheit, dass man sehr selten zweimal absäuft.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück durften wir draußen an Oberdeck bleiben und stellten fest, dass wir uns in einem imposanten Geleitzug befanden, der anscheinend nur aus schnellen Fahrgastschiffen und einer Zerstörereskorte bestand. Wir liefen sicherlich 16 bis 18 sm und würden bald die Straße von Gibraltar erreichen, wenn nichts außergewöhnliches passierte. Einer der englischen Offiziere kam und fragte uns, ob wir Interesse hätten, ein paar Worte mit unseren italienischen Verbündeten zu wechseln, von denen sie einige dutzend an Bord hätten. Er sagte geringschätzig „Eyeties“, was so viel wie unser „Itaker“ ausdrückt. Wir waren natürlich nicht abgeneigt und trafen die Italiener auf den Planken neben einer Ladeluke beim Sonnenbaden. Sie sahen erbarmungswürdig aus, abgerissen und ungepflegt, mit Bartstoppeln im Gesicht. Ihre Unterbringung in den tiefsten Tiefen des Schiffes war nicht mit unserer zu vergleichen. Sie hausten dort im wahrsten Sinne des Wortes, zum Teil seekrank mit unappetitlichen Begleiterscheinungen. Sie taten uns leid, wir gaben ihnen Zigaretten. Was konnten sie dafür, dass der Duce sie in einen Krieg gehetzt hatte, der für sie fast nur aus Niederlagen und Demütigungen bestand? Überheblich wie wir waren – und vielleicht immer noch sind – hatten wir sie stets nur als Soldaten dritter Klasse betrachtet, und nicht als einzige dachten wir so. Die Briten und ihre Verbündeten drückten ihre Überheblichkeit zu Beginn des Afrika-Krieges dadurch aus, dass sie die Gefangenen postwendend zu ihren Linien zurückjagten, jedoch nicht ohne vorher das Hinterteil aus ihren Hosen geschnitten zu haben.
Man beendete unseren Besuch bei den Italienern mit dem Hinweis, dass diese nun wieder in ihrer Höhle verschwinden müssten und wir in unsere Kammern eingeschlossen würden, damit wir in der Straße von Gibraltar nicht etwa über Bord jumpen und uns schwimmend davonmachen würden. Absurde Idee, wir wären gar nicht darauf gekommen, denn die Chance, dies unbemerkt zu tun, war gleich null und sie hätten uns wie Hasen auf der Treibjagd abschießen können. So gingen wir also in die Kammer des Leutnants und vertrieben uns die Zeit mit lesen und Kartenspielen. Zu meinem Bedauern, denn ich hätte Gibraltar gern gesehen mit seiner Straße, die als Nadelöhr auf dem Weg in das Mittelmeer so vielen unserer Boote zum Verhängnis wurde. An Deck durften wir erst wieder, als wir uns schon geraume Zeit im Atlantik befanden. Der Geleitzug holte weit aus, um der Biskaya und den U-Bootstützpunkten an der westfranzösischen Küste auszuweichen. Das war uns nur recht, denn auch wir hatten kein Verlangen, in den Bach zu gehen, wenn sich das Geleit den Wolfsrudeln zu nahe präsentierte.
Ganz ungeschoren kamen wir jedoch nicht davon. Scheinbar unbemerkt hatte sich dem Geleit eine unserer wenigen viermotorigen Focke Wulf 200 „Condor“, die in Bordeaux stationiert waren, und man jagte uns schnell in die Kammer zurück. Wir hörten das Motorendröhnen der schweren Maschine, das Bellen der leichten und mittleren Flak des Geleits und das dumpfe Detonieren der Bomben. Wir machten uns klein in der Kammer, legten die Skatkarten auf die Back und die Schwimmwesten an, man konnte nie wissen. Aber wir kamen ungeschoren davon, der Gefechtslärm verstummte und der Alarm wurde abgeblasen. Man erzählte uns, dass nichts Ernsthaftes passiert sei. Die Condor hätte zwar ihre Bomben abgeladen, jedoch nur near misses erzielt. Wie es der Zufall will, traf ich später den Piloten dieser Condor, Uffz. Gnüchtel, im Camp 15 in England wieder. Er wurde bei einem späteren Einsatz vom Himmel geholt.
Jede Reise geht einmal zu Ende und so landeten wir eines Morgens im Hafen von Liverpool, dem man die schweren Angriffe unserer Luftwaffe während der Battle of Britain nicht mehr ansah. Nach dem Festmachen des Schiffes wurden wir aufgefordert, unsere Sachen zu packen und an Oberdeck unsere Ausschiffung abzuwarten. Der Commanding Officer der Royal Marines kam noch einmal mit Begleitung zu uns, um sich zu verabschieden und ließ uns einen großen Pappkarton mit Sandwiches und Zigaretten übergeben. Außerdem erhielten wir die neue Liverpooler-Zeitung mit auf den Weg. Inzwischen war auch schon unsere Eskorte eingetroffen, ältere Daddies von der Home Guard mit einem martialisch aufgeputzten und dreinblickenden Oberleutnant, der als erstes gleich die Warnung aussprach, dass bei einem Fluchtversuch sofort von der Waffe Gebrauch gemacht werden würde. Wir grinsten nur. Nach den Kavalieren von den Royal Marines waren wir nun bei den etwas verunsicherten Kriegern des Heeres gelandet. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir verließen den Kahn. Ein letztes Winken zu den an der Reling stehenden Marines und wir waren wieder an Land. Ein LKW brachte uns zu einem Liverpooler Bahnhof, und dann standen wir als Attraktion für die Briten mindestens eine halbe Stunde auf einem Bahnsteig und warteten auf den Zug, der uns irgendwohin bringen würde. Wohin? Diese Frage beantwortete uns der Eskortenführer natürlich nicht. Wir hatten stattdessen Zeit und Muße, uns umzusehen. Es hatte sich eine größere Zahl von Leuten eingefunden, die uns staunend anstarrten. Ein böses Wort fiel nicht, nur einmal die Bemerkung: „Arrogant German Officers“, und eine Frau meinte, während sie auf mich deutete: „Poor young lad!“ Endlich kam der Zug und wir fanden uns in einem Abteil wieder, dessen Verdunklungsrollos herabgezogen waren, sodass wir nicht feststellen konnten, wohin die Reise ging. Der Offizier und zwei Mann leisteten uns im Abteil Gesellschaft, sprachen aber zunächst nicht mit uns. Der Oberleutnant hatte seinen Revolver demonstrativ auf dem Schoß liegen, was uns aber nur ein müdes Lächeln entlockte. Wir waren hungrig von der langen Fahrt, bedienten uns aus unserem Pappkarton und boten auch den Briten davon an. Sie lehnten ab, bekamen stattdessen ihren Tee gebracht und es muss fairerweise gesagt werden, sie boten nun ihrerseits uns davon an. Wir sagten natürlich nicht nein und so nahmen sie schließlich auch eine Zigarette von uns an und es entspann sich so etwas wie eine Konversation.
Auch diese Reise ging zu Ende. Wir stiegen auf einem großen Bahnhof aus und der Name „Paddington Station“, den wir gleich mehrfach wahrnahmen, machte uns die Feststellung nicht schwer, dass wir uns in London befanden. Im Geschwindschritt wurden wir aus dem Bahnhof gebracht und diesmal in einen Bus mit verhängten Fenstern, der uns schnell aus London forttrug. Nach längerer Fahrt hielt er schließlich in einem weitläufigen Park vor einer Steinbaracke, einer von mehreren, die von einem Stacheldraht umgeben waren. Man übergab uns einem anderen Empfangskomitee und wir fanden uns in einem fensterlosen Raum wieder. Den Pappkarton mit unseren Schätzen hatte man uns trotz unseres Protestes abgenommen. Dann wurden die beiden Leutnants aus dem Raum geführt; ich sah sie nie wieder. Schließlich holte man auch mich und brachte mich in eine Zelle, in der ein Obergefreiter der deutschen Marine saß. Er begrüßte mich überschwänglich; stutzig wurde ich, als er mich gleich nach Flottille und Bootsnummer fragte. Ich legte die Finger auf die Lippen und bedeutete ihm, dass wir uns doch wohl in einem Verhörlager befänden und es sicher eingebaute Mikrophone gäbe. Dass er dieses strikt verneinte, bestärkte mich in meiner Vermutung, dass der Bursche nicht koscher sei, und ich erinnerte mich an die Belehrung, die wir über das Verhalten in Gefangenschaft bekommen hatten. Rede mit keinem über militärische Dinge, den du nicht kennst. Mein Verdacht bestätigte sich später, er hatte dieselbe Masche auch bei anderen versucht. Er wurde dann bald abgeholt und kam nicht noch einmal in meine Zelle zurück.
Ich befand mich tatsächlich in einem Verhörlager, dem berüchtigten „Camp 1“ in der Gegend von Oxford, das dem Roten Kreuz nicht als Lager gemeldet war. Doch das erfuhr ich erst später. Schließlich holte man mich und brachte mich zum ersten Verhör. Eine Tür wurde geöffnet und ich befand mich in einem größeren Raum mit zwei Schreibtischen, hinter denen britische Marineoffiziere saßen. Da machte ich meinen ersten Fehler: Ich erwies den Offizieren einen militärischen Gruß, der natürlich, weil ich keine Kopfbedeckung trug, aus dem sogenannten deutschen Gruß bestand. Ich hatte kaum die Hand gehoben, da verspürte ich einen harten Schlag im Kreuz und jemand riss mich aus dem Zimmer und sperrte mich in einen größeren Raum, der ursprünglich anderen menschlichen Bedürfnissen vorbehalten war. Da stand ich nun mit schmerzendem Rücken ziemlich dumm in der Gegend. Da der Raum eine zweite Tür hatte, öffnete ich diese, neugierig wie jeder POW, und fand zu meinem Erstaunen einen Waschraum mit Duschen vor. Probeweise ließ ich etwas Wasser laufen und oh Wunder, es gab sogar warmes. Schnell war ich aus meinen Sachen und gab mich einem erfrischenden, ausgiebigen Duschvergnügen hin. „What the hell are you doing? “ Bellte mich jemand an, es war der rabiate Posten. “Can you see? I`m taking a bath,” war meine Antwort. “You better get dressed, or I will kick you again!” schnautzte er, und ich zischte zurück: “Just try if you want to lose a couple of teeth.” Der Stoß in den Rücken war übrigens die einzige Tätlichkeit, die ich seitens der Bewacher während meiner Gefangenschaft erfuhr mit Ausnahme der Androhung mich umzulegen, die später von einem kanadischen Offizier kam, als man mich auf einer Flucht wieder gefaßt hatte. Doch darüber wird später zu berichten sein.
Der Posten brachte mich in meine Zelle zurück und zu meiner Überraschung fand ich dort einen anderen deutschen Seemann vor. Der schien aber echt zu sein, er stellte mir keine dummen Fragen. Wir machten uns bekannt und er erzählte mir, dass sein Boot bei einem Angriff auf einen Geleitzug durch Wasserbomben an die Oberfläche gezwungen und im Kreuzfeuer der Geschütze des Geleits zusammengeschossen und versenkt worden war. Er und ein paar seiner Kameraden wurden von einem Zerstörer aufgefischt und landeten einige Stunden später wieder im Wasser, als der Zerstörer, ich glaube es war die „Harvester“, von einem deutschen U-Boot torpediert und versenkt wurde. Mein Gegenüber hatte das unvorstellbare Glück gehabt, zum zweiten Mal aufgefischt zu werden. Wenn sich jemand einmal die Mühe machen würde, die Geschichte der Überlebenden des U-Bootkrieges zusammenzutragen, würden unglaubliche Berichte publik werden, die die ganze Grausamkeit dieser Art des Seekrieges dokumentieren könnten.
Am Abend dieses für mich so ereignisreichen Tages erwartete uns noch eine besondere Überraschung. Ein Posten kreuzte auf und bot uns Sandwiches aus der mir abgenommenen Kiste im Tausch gegen Souvenirs an. Er war erstaunt, als ich ihm zu verstehen gab, dass ich mir gestohlene Sachen grundsätzlich nicht zurückkaufe und dass man einem nackten Mann nicht in die Taschen fassen könne, man hatte uns ja praktisch bereits alles abgenommen.
Ich weiß nicht, ob er die englische Version dieser deutschen Redensart verstand; er zog jedoch vor, ohne weitere Diskussion zu verschwinden. Jedenfalls wurde mir an diesem ersten Tag auf englischem Boden bewusst, dass die Behandlung des gefangenen Gegners durch die Fronttruppe sich erheblich von der in der Etappe unterschied. Aber das mochte für beide Seiten gelten, und im Großen und Ganzen war die Behandlung durch die Briten und Kanadier fair.
Am nächsten Vormittag, nachdem wir uns bei einem Spaziergang in einem parkähnlichen Gelände ausgelüftet hatten, wurde ich wieder zum Verhör gebracht. Durch Schaden klug geworden, behielt ich nach dem Betreten des Verhörraums ostentativ meine rechte Hand in der Hosentasche, um gar nicht in die Versuchung zu kommen, sie anderweitig zu gebrauchen. Die Provokation wurde jedoch nicht zur Kenntnis genommen und der Verhöroffizier, wieder von der Royal Navy, forderte mich auf, Platz zu nehmen. Er stellte sich sogar vor, wenn auch sicher nicht mit seinem wirklichen Namen. Ehe er mir die erste Frage stellen konnte, kam ich ihm zuvor, nannte meinen Namen und Dienstgrad und fügte hinzu, dass ich meine Erkennungsmarkennummer nicht wüsste, da man mir diese abgenommen habe. Im Übrigen sei das alles, was er von mir erfahren würde. Er grinste nur und machte mir klar, dass er das respektiere, aber dass ich doch wohl nichts gegen eine Unterhaltung allgemeiner Art hätte. Die angebotene Zigarette nahm ich an, damit konnte und wollte er mich wohl auch nicht bestechen. Dann erzählte er mir, von welcher Flottille ich käme, sagte mir meine Bootsnummer und nannte mir den Namen des Alten sowie sämtliche Offiziere des Bootes. Er fuhr damit fort, fast alle anderen Kommandanten der Flottille aufzuzählen sowie den Bootsnummern der Boote, zu denen sie gehörten. Dass die Briten das alles wussten, versetzte mich in Erstaunen, obwohl wir immer davon ausgegangen waren, dass die königstreue italienische Marine nicht ganz koscher war und von unseren Verbündeten dem Gegner noch wichtigere Dinge als Namen und Nummern übermittelt wurden. Ich mimte jedoch den unbeeindruckten und bemerkte kühl, dass Namen Schall und Rauch seien. Ich glaube, dass er das verstand, denn er sprach ein ausgezeichnetes Deutsch. Die Unterhaltung plätscherte dahin, er ließ Kaffee kommen, fragte nach meinen Familienverhältnissen, woher ich stamme, nach Eltern und Geschwistern, schob aber ab und zu eine Fangfrage ein, sodass ich höllisch aufpassen musste, um nicht überrumpelt zu werden. Schließlich schien er genug zu haben, rief einen Posten und ließ mich zurück in die Zelle bringen.
Es vergingen ein paar Tage mit weiteren Verhören durch andere Offiziere. Schließlich sagte ich überhaupt nichts mehr und schlug vor, mich doch in ein Gefangenenlager zu bringen, da man doch inzwischen erkannt haben müsse, dass das ganze Theater „a waste of time effort“ sei. Aber eines Morgens wurde ich erneut geholt und ein Verhöroffizier fuhr mich an, ich habe gelogen, bei der Angabe meiner Familienverhältnisse. Ich habe zwei Schwestern, aber keinen Bruder erwähnt, und nun sei mein Bruder hier in diesem Camp. Ich lachte schallend und sagte, dass es sich hier nur um einen Fehltritt meines Vaters handeln könne, den er der Familie bisher erfolgreich verschwiegen habe. Und falls das alles zuträfe, wäre der angebliche Bruder noch lange kein Rahn. Darauf wurde mir mein angeblicher Bruder vorgestellt. In der Tür stand ein Fähnrich im vergammelten U-Boot Päckchen. Er gab mir die Hand und sagte „Rahn“, ich schaute ihn an, lachte und sagte ebenfalls „Rahn“. An unseren verdutzten Gesichtern musste man erkennen, dass wir uns nie begegnet waren und der Verhöroffizier nahm uns ab, dass wir weder verwandt noch verschwägert seien. Man steckte uns dann aber auf unsere Bitte in eine gemeinsame Zelle, wo Ullrich Rahn, Fähnrich z. S. aus dem Mecklenburgischen, mir seine Story erzählte. Auch die Geschichte seines „Absaufens“ war „stranger than fiction“: Sein Boot hatte im Atlantik vor der Straße von Gibraltar operiert. Sie liefen über Wasser, als plötzlich ein anderes deutsches U-Boot, das zusammen mit ihnen im gleichen Seegebiet operierte, in unmittelbarer Nähe auftauchte. Man war noch dabei, Begrüßungen auszutauschen, als das andere Boot, vermutlich durch ein falsches oder falsch interpretiertes Ruderkommando auf Kollisionskurs ging und ihr Boot voll breitseits rammte. Beide Boote wurden hierbei so schwer beschädigt, dass sie innerhalb kürzester Zeit absoffen; dem größten Teil beider Besatzungen gelang es jedoch noch, die Boote zu verlassen, und so trieben sie, teils in Schlauchbooten, teils in ihren Schwimmwesten im Wasser. Ulrich lag gerade in der Koje, als sich der Zwischenfall ereignete und meinte, dass er noch nie so schnell aus derselben herausgekommen sei. Die starke Dünung und die heranbrechende Nacht trieben dann die Schwimmenden auseinander, die meisten überlebten die Nacht nicht und nur wenige wurden im Laufe des nächsten Tages durch britische Oberwasserstreitkräfte aus dem Meer gezogen.
Ulrich und ich waren in keiner Weise verwandtschaftlich verbunden und waren uns, da er einer anderen Crew angehörte, auch vorher nie begegnet. Wir blieben zusammen, langweilten uns in unserer Zelle und vertrieben uns die Zeit beim Knobeln mit Streichhölzern. Einsatz war das Reinigen der Zelle, das täglich einmal durchzuführen war. Wie immer hatte ich im Spiel sagenhaftes Glück und der arme Ulrich war auf lange Zeit zum täglichen Reinschiff verurteilt. Die Monotonie des Tagesablaufs wurde nur durch gelegentliche weitere Verhöre unterbrochen. Eines Nachts wachte ich jedoch mit wahnsinnigen Zahnschmerzen auf und meldete mich auf die morgendliche Frage des Duty Officers „any complains?“ als Zahnkrank. Ein MO (Medical Officer) schaute mir kurz in den Mund und, welch Wunder, eine Stunde später saß ich schon in einem Sanka und wurde zum Zahnarzt gefahren, der mir im Schnellverfahren drei Zähne aufbohrte und mit Füllungen versah. Anscheinend verstand er sein Handwerk, denn die Schmerzen waren wie fortgeblasen und kehrten auch nicht wieder. Erst Jahre später in Deutschland wunderte sich ein Zahnarzt über das Material der Füllungen, die man mir in England verpasst hatte.
Nach etwa 14 Tagen Aufenthalt in Camp I hatte man offenbar eingesehen, dass nichts aus uns herauszuholen war, und so wurde uns eines Morgens eröffnet, dass wir verlegt würden. Wohin? Auf diese Frage erhielten wir wieder keine Antwort. In einem Kleinlaster der Army wurden wir eine ziemliche Strecke weit gefahren und konnten durch einen Schlitz in der Plane ausmachen, dass wir in eine größere Stadt kamen; aufgrund der Firmenschilder konnten wir auch feststellen, dass wir uns in London befanden. Schließlich bogen wir in eine Straße ein, die als „Private Road“ gekennzeichnet war und wurden im Hof eines imposanten alten Gebäudes ausgeladen. Man brachte uns in einen Raum mit vergitterten Fenstern, durch die wir einen guten Blick auf die „Private Road“ und die umliegenden Gebäude hatten. Die gegenüberliegenden Gebäude beherbergten anscheinend eine Dienststelle der Royal Air Force, denn wir sahen viele Personen beiderlei Geschlechts in Luftwaffenuniform dort ein- und ausgehen. Schlecht erzogen, wie wir beide waren, versuchten wir die weiblichen Uniformträger durch Pfeifen auf uns aufmerksam zu machen. Die meisten reagierten nicht, aber die eine und andere nahm Notiz von uns und winkte. So fanden wir unseren Aufenthalt im sogenannten „Cage“, einem politischen Verhörlager, das sich in der ehemaligen rumänischen Botschaft irgendwo in Kensington befand, ganz amüsant.
Natürlich gingen auch hier die Verhöre bald los, und der Typ der Verhöroffiziere war ein anderer als im Camp 1. Nicht sehr sympathische Burschen, die mit Fragen, die uns stupide erschienen, unsere politische Gesinnung erforschen wollten. Da haben wir beide uns sicher sehr undiplomatisch verhalten. Von klein auf indoktriniert und als Fähnlein Führer im deutschen Jungvolk weiter gedrillt oder verdorben für eine objektive Beurteilung des Nationalsozialismus, machte ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, war frech und arrogant den Vernehmern gegenüber und handelte mir hier die Beurteilung C+ ein, die später Auswirkungen auf meinen Entlassungstermin haben sollte. C+ war so ziemlich das Ende der Fahnenstange; die es bekamen, galten als unheilbare fanatische Nazis und Militaristen. Aber was konnte man damals von einem 19jährigen, der durch Internatserziehung und Jungvolk gegangen war, anderes erwarten?
Wir hatten auch bald heraus, warum diese Klapsmühle „The Cage“, der Käfig genannt wurde. Beim täglichen Luftschnappen sperrte man uns in einen im Garten gelegenen Käfig, der nicht nur an den Seiten aus Maschendraht bestand, sondern auch ein Dach daraus besaß. Er war zwar geräumig aber wenig zum Auslauf geeignet und absolut „escape proof“. Da wir uns wie eingesperrte Raubtiere fühlten, verhielten wir uns entsprechend und fauchten und zischten vorübergehende Bedienstete des Verhörlagers an oder knurrten bösartig. Sicher haben diese gedacht, dass wir nicht alle Tassen im Schrank hätten, oder den Eindruck gewonnen, die bloody Germans seien wirklich wilde Tiere.
Um diese Zeit hatte die Luftwaffe längst die Battle of Britain verloren und im Großen und Ganzen schien London wieder besseren Zeiten entgegenzusehen. Aber man hatte sich wohl zu früh gefreut. Eines Nachts heulten die Sirenen los und einer unserer Wächter teilte uns mit, dass er jetzt in den Luftschutzkeller ginge und wir sollten die bloody German Air Force schön von ihm grüßen. Wir blieben in unserer Zelle und hatten wieder einmal einen Logenplatz für die Beobachtung eines deutschen Luftangriffs. Die Luftwaffe hatte eine neue Taktik entwickelt und schickte wegen der hohen Bomberverluste jetzt FW 190 als Jagdbomber in kleinen Gruppen nach London, weniger um Schaden anzurichten als Unruhe zu stiften, die Londoner aus ihren Betten zu holen.
Von unseren Betten aus konnten wir das Spiel der Scheinwerfer, die Leuchtspur der mittleren Flak und die Detonation der Geschosse der schweren Flak gut beobachten. Dazwischen war deutlich das Motorenheulen der angreifenden Focke Wulf zu vernehmen. Ganz wohl war uns jedoch nicht. Der Gedanke, durch einen Bombentreffer zu sterben, nachdem der Krieg für uns bereits „gelaufen“ war, und noch dazu durch eine deutsche Bombe, war nicht amüsant. So überdeckten wir unsere Nervosität und unterschwellige Angst mit dem lauten Singen deutscher U-Bootlieder, und wie wir auf die verrückte Idee kamen, außerdem „Tenno, Haika, Banzai“ zu schreien, ist mir heute nicht mehr klar. Da wir jedoch nur wenige und noch dazu weit entfernte Bombendetonationen hörten, kamen wir zu dem Schluss, dass es sich bei den deutschen Angriffen um nicht mehr, als Nadelstiche handelte. Das gab uns für spätere Angriffe das nötige Selbstvertrauen und die Gewissheit, dass uns in Kensington kaum etwas passieren würde.
Endlich haben auch die Vernehmer in Sachen Politik die Nase von uns voll, und so durften wir wieder unsere Sachen packen und uns erneut auf die Reise ins Unbekannte begeben. Dass das Ziel diesmal ein ganz normales POW-Camp und kein Vernehmungslager sein würde, war aber so gut wie sicher. Denn außer über unser Liebesleben vor der Gefangenschaft hatte man uns so ziemlich über alles ausgehorcht, selbst über unsere religiöse Einstellung.
Wir traten eine sehr lange Fahrt per Bahn an, stiegen in Crewe um und erreichten als Endstation Penrith nicht weit von der schottischen Grenze, in der Grafschaft Cumberland gelegen. Dort wurden wir schon erwartet und die Fahrt ging per LKW weiter durch Snap in Westmorland zu einem in einer öden Hochmoorlandschaft gelegenen Gebäudekomplex, der, in einem Rechteck angelegt, einen kleinen Innenhof umgab: Snap Wells Hotel, in dem sich das POW-Camp 15 befand.
Wir fuhren mit dem LKW bis in den Innenhof, wo man uns bedeutete, abzusteigen. Durch den Dienstboteneingang gelangten wir dann in den von der britischen Lagerleitung besetzten Flügel, wo man unsere Papiere überprüfte und uns dann durch eine Tür in den deutschen Teil des Hotels, dem eigentlichen Gefangenenlager entließ. Dort wurden wir vom Adjutanten des deutschen Lagerführers in Empfang genommen, der uns zu seinem Chef brachte. Wir meldeten uns also bei Oberstleutnant B., einem Fallschirmjägeroffizier. Nach kurzem Willkommen und den üblichen Fragen nach Zeit und Ort der Gefangennahme, führte uns der Adju dann zu dem Zimmer, das Ulrich und ich beziehen sollten. Auf dem Weg dorthin mussten wir eine Art Aufenthaltsraum durchqueren, in dem sich eine größere Anzahl deutscher Offiziere aller Teilstreitkräfte, vorwiegend aber von Luftwaffe und Marine, befand. Es waren einige bekannte Gesichter unter ihnen, und es erhob sich sogleich ein wildes Willkommensgejohle wie: „Ich werde verrückt, der kleine Rahn ist da!“ und „Jetzt haben sie den Steppenwolf (so wurde ich in der Crew genannt) auch erwischt!“ Ja, Unkraut vergeht nicht. Auch zwei Kommandanten unserer Flottille waren da, Kaleu Freiherr von Tiesenhausen, der die „Barham“ versenkt hatte, und Götz Bauer. Alle wollten natürlich neue Nachrichten von der Flottille haben, aber mein Wissenstand war auch nicht mehr der Frischeste. Leider konnte ich Fragen nach Booten und Kommandanten oft nur mit dem Hinweis beantworten, dass die Boote überfällig waren. Das bedeutete in den meisten Fällen Totalverlust, niemand gerettet. Zum Zeitpunkt unserer Versenkung hielten sich die eigenen Verluste eigentlich noch in Grenzen, verglichen mit dem, was noch kommen sollte. Wir waren der 17. Verlust; das hieß immerhin, dass mehr als die halbe Flottille hatte dran glauben müssen. Neu eintreffende Boote glichen jedoch bisher die Verluste in etwa immer aus.
Mit der Bemerkung, dass wir sicher noch ein paar Jahre Zeit hätten, um alle Fragen zu beantworten, drängte der Adju zum Aufbruch, um uns unser Zimmer zuzuweisen. Es lag im ersten Obergeschoß, war ziemlich geräumig und hatte zwei Fenster zum Innenhof. Die Fenster waren mit daumendicken Eisenstäben vergittert, um Ausflüge unmöglich zu machen. Von einem der doppelstöckigen Betten hatte sich bei unserem Eintreten ein Marinefähnrich erhoben, den der Adju uns vorstellte. Wir drei sollten für die nächste Zeit eine Wohngemeinschaft bilden. Zielke, unser Stubengenosse, machte uns dann erst einmal mit den Besonderheiten des Lagers vertraut, nannte uns die Pöstcheninhaber und ihre Eigenschaften und sagte, das verdammte Lager sei für die Offiziere ein Sanatorium, für Fähnriche aber eine Zweigstelle der Marineschule Mürwik. Jeden Tag mindestens drei Stunden Unterricht und Hausaufgaben. Was für eine ungerechte Welt. Des Lobes voll war er über den deutschen Lagerführer, Oberstleutnant B., der seinem britischen Pendant das Amt schwermachte. Diesem, einem älteren schottischen Major, der im Winter und Sommer im Kilt umherspazierte, heizte er tüchtig ein und verstand es, Forderungen für das Lager mit dem Hinweis durchzusetzen, dass er, wenn diese nicht erfüllt würden, einem Dutzend deutscher Offiziere den Befehl zum Ausbruch aus dem Lager geben würde, und dann geriete er, der Schotte, doch in erheblichen Trouble. Dieses Argument wirkte, jedoch auch, weil B. stets zu klug war, unmögliches zu fordern.
Dann war es auch schon Zeit zum Mittagessen. Z. nahm uns mit in den großen Speisesaal, wo der Lagerführer uns vorstellte. Man fühlte sich unwillkürlich in eine deutsche Offiziersmesse versetzt, denn das Essen wurde von Backschaften aufgetragen und wir brauchten uns auch nicht um das schmutzige Geschirr zu kümmern. Die Ordonanzen, alles deutsche Mannschaftsdienstgrade, wurden von uns für ihre Tätigkeit bezahlt, denn wir bekamen monatlich ein ausreichendes Taschengeld in Form von Lagergeld. Diese Art von Gehaltszahlungen beruhte auf Gegenseitigkeit. Die Briten erhielten in deutschen Lagern ebenfalls ein Taschengeld in gleicher Höhe. Dieses war, wie konnte es anders sein, nach Dienstgraden gestaffelt.
Aber viel hatte die Lagerkantine ohnehin nicht anzubieten, den Briten draußen ging es auch nicht rosig. Toilettenartikel, Zigaretten, Softdrinks und ab und zu mal eine Flasche Bier waren in etwa das, was man käuflich erwerben konnte. Dieser Sold wurde übrigens bis Ende 44 gezahlt und trug dazu bei, dass man nicht „vergammelte“. Nach dem Essen machte Z. mit uns einen Rundgang durch das Lager. Der Auslauf im Freien war nicht überwältigend groß, aber immerhin, man konnte sich bewegen und in Form halten. Über eine Freitreppe, die dem Hauptausgang vorgelagert war, gelangte man zunächst auf eine kleine Liegewiese, die mit Liegestühlen vollgestellt, der allgemeinen Siesta diente. Diese Wiese wurde durch einen an beiden Ufern eingezäunten Bach begrenzt. Über den Bach führte eine Brücke, auf die man durch eine Pforte im Zaun, die tagsüber offenstand, gelangte. Hinter dem Bach war dann der große Auslauf, mit einer Fläche von ca. 100 x 200 m, seine markanteste Einrichtung eine Reihe von Kaninchenställen, die sich unmittelbar hinter dem Zaun am jenseitigen Ufer des Bachs befanden, und deren Insassen zur Bereicherung des Speisezettels bestimmt waren. Ein findiger POW hatte einmal versucht, sich in den Ställen zu verstecken, um in der Dunkelheit nach Schließung der Pforte von dort aus das Weite zu suchen. Er hatte jedoch seine Rechnung ohne den Wirt gemacht, ausgerechnet an diesem Tage hatte man vor der Schließung der Pforte auch die Kaninchenställe kontrolliert und den nach Stallhasenmist stinkenden POW aus seiner Behausung geholt und für einige Tage in den Knast gesteckt. Eine Maßnahme, die an und für sich nicht den Regeln der Genfer Konventionen entsprach, denn ein Kriegsgefangener durfte für einen Fluchtversuch nicht bestraft werden. Man fand jedoch immer eine Ausrede, das Einsperren zu rechtfertigen. Entweder war Staatseigentum beschädigt worden oder etwas anderes wurde an den Haaren herbeigezogen. In diesem Falle hatte der POW wahrscheinlich das Wohlbefinden von Kaninchen gestört.
Der Bach selbst war auch schon als Fluchtweg von zwei Gefangenen benutzt worden. Leutnant Fröschler (er galt als Escaper Nr. 1), ein aus Österreich stammender Jägerpilot, der immerhin ein gutes Dutzend „Kanaltommies“ abgeschossen hatte, ehe man ihn selbst herunterholte, hatte sich mit einem zweiten POW von der Brücke in das Bachbett gleiten lassen und im toten Winkel des dem Gebäude zugewandten höheren Bachufers bis zum Zaun vorgearbeitet, der auch den Bach gegen die Außenwelt abschirmte. Da der Zaun nicht im Bach verankert war, waren sie ohne Schwierigkeiten darunter hindurchgekrochen und in einem anschließenden Waldstück verschwunden. Einen Haken hatte die ganze Eskapade jedoch gehabt. Die Flucht war zu einem Zeitpunkt erfolgt, als man in Gefangenenkreisen Handschellen trug, ein Vorgang, der bisher einmalig in der deutsch-britischen Kriegsgefangenengeschichte war. Die Ursache der ganzen Affäre war ein kleiner Zwischenfall, der durch wechselseitige Dummheit eskalierte. Britische Kommandos hatten einen Raid auf das von Deutschen besetzte Nordnorwegen durchgeführt und dabei einige deutsche Gefangene gemacht. Damit diese ihnen nicht weglaufen konnten, hatte man sie gefesselt, was bis dato nicht üblich war. Irgendwie bekam die deutsche Führung davon Wind und hatte nichts Besseres zu tun, als „retaliation in kind“ zu üben. Die Gelegenheit dazu ergab sich bei dem Desaster eines britisch-kanadischen Landungsversuchs an der Kanalküste. Dabei fesselte man eine Anzahl Briten und Kanadier. Prompt erfolgte von der anderen Seite eine Fesselung deutscher Gefangener in den meisten Lagern Englands. Woher man unversehens die große Menge an Handschellen hatte beschaffen können, bleibt ein Rätsel. Tatsache ist jedoch, dass die findigen POWS bald einen Weg entdeckten, die Handschellen zu öffnen und sie mit diversen Schlagwerkzeugen zu Schrott zu machen.
Fröschel allerdings war es am Morgen seiner Flucht nicht gelungen, sich der Fesseln zu entledigen, und so entfloh der Besessene gefesselt und wurde seine Handschellen erst außerhalb des Lagers mit Hilfe seines Kameraden los. Aber die beiden kamen nicht weit und landeten bald wieder im Lager, um ihre 28 Tage „Detention“ abzusitzen.
Flucht war der Hauptgesprächsstoff in jedem Lager in England und auch sonstwo, obgleich die Chancen, nach Ausbruch aus dem Lager nach Hause zu kommen, natürlich fast null waren. Großbritannien war nun mal eine Insel, von der man nur per Boot oder Flugzeug entkommen konnte. Niemand hat es geschafft, viele haben es versucht. Besonders tragisch war die Flucht des 1 WOs des Bootes von Karl Ramlow, dessen Boot von den Briten gekapert worden war. Er entfloh aus Camp 15, um das Boot zu suchen und zu zerstören, sagt man. Andere meinen, er suchte den Tod, weil er mit der Schmach nicht leben konnte. Er wurde kurz nachdem er das Lager verlassen hatte, von den Briten erschossen, als er auf ihren Anruf nicht stehenblieb. Eine Bestätigung dieser Geschichte hatte ich allerdings bis heute in keiner Dokumentation gefunden.
Nach einem sehr aufregenden Tag kam nun also meine erste Nacht in Camp 15. Nach dem Roll Call wurden wir in unsere Stuben eingeschlossen, klönten noch eine Weile und dann war Stille, die nur vom Geschrei der Posten auf ihren Türmen und auf Streife unterbrochen wurde. In vorgeschriebenen Zeitabständen hatten sie sich zu melden, um sicherzustellen, dass keiner eingeschlafen war. So ertönte wieder und wieder der Ruf: „Number one post, and all is well!“ Das ging so weiter die ganze Nacht durch, und da vier Türme nachts besetzt waren, pflanzte sich der Ruf von 1 – 4 fort. Dazwischen wurden die Streifen, die rund um das Lager patrouillierten, von den Türmen aus angerufen, wenn sie in Sichtweite gelangten. Das hört sich so an: „Halt, who goes there?“ „A friend!“ „Advance friend to be recognized, halt, pass friend and all is well!” Es hat mich in der ersten Nacht in Snap ganz schön genervt, aber man gewöhnt sich an alles, und so störte es mich bald nicht mehr.
Die Tage in Camp 15 liefen nach einer monotonen Routine ab. Roll Call früh und abends, Unterricht am Vormittag, Rundendrehen im Auslauf, Kartenspielen, lesen, klönen und Fluchtpläne schmieden. Wie alles bürokratisch abläuft, wo sich Deutsche befinden, unterlagen auch Fluchtpläne vor ihrer Ausführung der Überprüfung des Planes durch den Fluchtoffizier und sein Expertengremium. Es wurden die Chancen geprüft, und ob er nicht mit anderen, besseren Plänen kollidierte. Dies hatte, obwohl wir es damals nicht einsehen wollten, durchaus seine Berechtigung.
Die beste Gelegenheit, sich davonzumachen, wäre bei den Spaziergängen außerhalb des Lagers gegeben gewesen, die ein- oder zweimal wöchentlich stattfanden. Das war aber tabu, denn vor den Spaziergängen mussten wir schriftlich unser Ehrenwort geben, dass wir diese Vergünstigungen nicht zur Flucht nutzen würden. Daran hielt sich jeder, obwohl wir natürlich während der Spaziergänge, bei denen uns eine Anzahl bewaffneter Posten begleitete, das Gelände sondierten und uns die besten Fluchtwege in der unmittelbaren Nachbarschaft des Camps einprägten. Nach ein paar Wochen in Shap machte sich noch einmal meine Verwundung bemerkbar. Ich hatte plötzlich unerträgliche Kopfschmerzen, und ein mitfühlender Arzt überwies mich zur eingehenden Untersuchung in ein Lazarett am anderen Ende der Insel. So fuhr ich per Bahn mit einem Posten nach Süden und landete schließlich in Wales, und zwar in Chepstow, einem kleinen Landstädtchen am Westufer des Wye, nahe dessen Mündung in den Severn. Das Lazarett lag etwas außerhalb des Ortes und verfügte auch über einen Block, in dem verwundete und kranke deutsche Kriegsgefangene untergebracht waren. Nach dem üblichen Zeremoniell der Aufnahme lernte ich eine Anzahl interessanter deutscher Offiziere kennen und brachte auch in Erfahrung, dass man hier in Chepstow die Untersuchung von Gefangenen vornahm, die aufgrund ihrer Verwundungen für einen Kriegsgefangenenaustausch zwischen Deutschland und den Alliierten vorgesehen waren. Irgendwie gelangte auch ich in den Kreis derer, die man austauschen wollte; dies sicher nur durch das Wohlwollen eines mitleidigen Arztes, denn mein Zustand hatte sich bald durch eine gut anschlagende medikamentöse Behandlung so gebessert, dass ich an und für sich die Bedingungen eines Austausches kaum erfüllte. Wie dem auch war, ich gelangte bis in die Schlussuntersuchung, die unter anderem von einer Ärztin, einer älteren Dame im Majorsrang, vorgenommen wurde. Sie schaute mich eingehend an und sagte nach der Untersuchung: „I`m not going to send you home, son, because you will board the next submarine and get killed.“ Dieser klugen Frau verdanke ich vermutlich mein Leben, denn der Krieg hätte mit Sicherheit auch mich verschlungen, wenn ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt wäre. Im Augenblick ihrer Entscheidung wollte ich sie allerdings vor Enttäuschung umbringen.
Ich ging also nicht an Bord des schwedischen Dampfers Gripsholm, als der Austausch im Oktober 1943 Realität wurde.
Ich blieb noch einige Tage im Krankenhaus und genoss deutsche Dauerwurst, die über das Rote Kreuz in das Lazarett gekommen war.
Dann geschah noch ein kleines Wunder. Man hatte mir an Bord der Sahib alles abgenommen, was man in meinen Taschen gefunden hatte. Das wurde mir eines Tages hier im Lazarett ausgehändigt. Es bestand aus einer Nagelfeile, einem abgebrochenen Kamm, einer Erkennungsmarke und einem Brief meiner Freundin Rosemarie, den man allerdings nicht mehr entziffern konnte, da das Seewasser die Tinte verwischt hatte.
Als „fit as a fiddle“ wurde ich dann wieder nach Shap geschickt, und es wurde eine angenehme Fahrt. Der Posten, der mich begleitete, war ein vernünftiger älterer Herr, der stolz war, einen German-submariner zu eskortieren. In Crewe mussten wir längere Zeit auf den Anschlusszug nach Carlisle warten, und so zog er mit mir in einen Dienstraum der British Railways und besorgte als erstes Tee und etwas zu essen für uns beide. Dann brachte er mir „Darts“ bei, das heute auch in Deutschland beliebte Wurfspiel mit Pfeilen auf eine Korkscheibe. Als wir davon genug hatten, ließen wir uns nieder und dösten vor uns hin. Auf einem Tisch vor mir lag ein Buch, das die Fahrpläne der britischen Eisenbahn enthielt. Ich blätterte darin herum und fand zu meinem großen Vergnügen eine gute Karte des nördlichen Englands. Irgendwie brachte ich es fertig, die Karte unbemerkt aus dem Buch herauszureißen und in meiner Tasche zu verstauen, denn in einer Belehrung hatte uns der Fluchtoffizier angewiesen, alles mitgehen zu lassen, was man für eine Flucht brauchen konnte. Brav, wie ich war, lieferte ich sie nach meiner Rückkehr prompt bei ihm ab.
Zu meinem großen Erstaunen fand ich nach meiner Ankunft in Camp 15 eine fast vollständig neue Crew vor. Die alte hatte man während meiner Abwesenheit nach Kanada verfrachtet. Leutnant Fröschel hatte es aber nicht erwischt. Der hatte sich gesagt, dass die Flucht aus Kanada noch unwahrscheinlicher sei als die von England aus. Konsequent wie er war, hatte er sich beim Bekanntwerden der Verlegung einen Stechbeitel in den Oberschenkel gerammt und war als transportunfähig zurückgelassen worden.
Ich bezog wieder mein altes Zimmer, in dem ich zu meiner großen Freude einen Crewkameraden, Wanne mit Spitznamen, als stolzen Oberfähnrich vorfand. Er war auch U-Bootfahrer und im Atlantik abgesoffen. Wanne sollte nicht der einzige Crewkamerad in Shap bleiben. Bald darauf trafen Hanne Brix und Carsten Schröck ein. Beide waren auf Versorgern, sogenannten Milchkühen gefahren. Das waren U-Boote, deren Aufgabe in der Versorgung weit draußen im Atlantik operierender Boote mit Torpedos, Treibstoff und Verpflegung bestand, damit diese sich länger in See halten konnten und somit Zeitverluste durch an- und Rückmarsch eingespart wurden. Hannes fuhr auf U-462, Kommandant Kaleu Bruno Vowe und Carsten auf 461, Kommandant Korvettenkapitän Stiebler. Beide waren am gleichen Tag, am 30.07.43, „geknackt“ worden.
Da ich im Moment der einzige Fähnrich im Shap war, erhielt ich, dem Himmel sei Dank, nur noch sporadisch obligatorischen Unterricht. Kaleu Vowe war ein einsichtiger Navigationslehrer, bei dem Unterricht Spaß machte. Vor allen Dingen war er als ehemaliger Handelsschiffskapitän ein Experte auf diesem Gebiet.
Unser ganzes Denken beschäftigte sich aber weiterhin mit Fluchtplänen. Wir wollten einfach raus aus dem Käfig, und versuchen, über die irische See in die Republik Irland und von dort nach Hause zu gelangen. So fingen wir an, mit einfachen Tafelmessern den Gitterstab eines Fensters vor unserem Zimmer zu bearbeiten und stellten fest, dass die Eisenstäbe durchaus mit dieser Methode zu knacken waren. Die Lage des Innenhofs zu unserem Zimmer begünstigte das Vorhaben, denn im Gegensatz zu den nach außen gelegenen Räumen wurden unsere Fenster nicht durch Scheinwerfer angestrahlt. Wir vier arbeiteten Nacht für Nacht in vier Schichten und kamen Millimeter für Millimeter tiefer in den Staub hinein. Da die Stäbe nicht mit der Oberkante der Fenster abschlossen und durch eine waagerechte Schiene in halber Höhe der Fenster geführt waren, hoben wir den zu bearbeitenden Stab so weit an, dass wir die Schnittstelle nach getaner Nacharbeit wieder in der Schiene verschwinden lassen konnten. Zur weiteren Tarnung verschmierten wir die Schnittstelle noch mit weichgekautem Brot. Es dauerte einige Wochen, bis wir unser Ziel erreichten. Oft waren wir drauf und dran gewesen, aufzugeben, hatten uns aber immer wieder überwunden, weiterzumachen. Dann kam der große Augenblick. Der Stab war durchgeschnitten, und wir hoben ihn vorsichtig heraus. Die Öffnung war groß genug, um uns schmale Heringe durchzulassen. Eingedenk des Fehlschlages mit der Abflußröhre in Afrika zwängte ich mich hindurch, um die Probe aufs Exempel zu machen. Wir beschlossen, in der folgenden Nacht eine Erkundung zu starten, um die günstigste Stelle für das Überwinden des Zaunes festzustellen. Am nächsten Morgen meldeten wir dem Fluchtoffizier unser Vorhaben, und er bewilligte uns Proviant für die Flucht unter der Voraussetzung, dass das Erkundungsergebnis positiv ausfiele. Wir sollten dann in der kommenden Nacht den Ausbruch wagen. Unser Plan sah vor, nach dem Verlassen des Lagers durch den Lake District bis zur Westküste durchzukommen, in einem kleinen Fischereihafen ein Boot zu stehlen und damit die irische See zu überqueren um den Freistaat Irland zu erreichen. Das weitere sollten wir dort beschließen.
Die Nacht der Erkundung kam heran, und da jeder von uns die Erkundung durchführen wollte, losten wir mit Hilfe von vier Streichhölzern den Gewinner aus. Ich hatte wie immer auch hier Glück und zog das abgebrochene Streichholz. Der Stab war schnell aus seiner Halterung entfernt, und ich zwängte mich durch die enge Öffnung. Vom Fenstersims aus, an dem meine Hände Halt fanden, konnte ich mit den Füßen ausgestreckt fast das Dach eines Vorbaus erreichen, der über die ganze Länge unserer Hausseite ging. Einmal auf dem Dach des Vorbaus, war es keine Schwierigkeit mehr, nach kurzer Lagepeilung an der Dachrinne hinunterzuklettern und den Boden des Hofes zu erreichen. Gerade als ich mich dazu anschicken wollte, öffnete sich aber die Tür des Vorbaus und einer der Posten, die ihre Wachstube darin hatten, kam heraus, um zu pinkeln. Er war anscheinend zu bequem, die paar Schritte zum Klo zu gehen. Da ich flach auf dem Boden lag, bemerkte er mich nicht und verschwand nach einiger Zeit, die mir wie eine Ewigkeit erschien, wieder im Gebäude. Schnell kletterte ich vom Dach herunter und schlich die Hausmauer entlang zu einer der beiden Toreinfahrten, die aus dem Innenhof herausführten. Die eine konnte ich vergessen, sie führte direkt zum Haupttor des Lagers und kam für die Flucht nicht in Frage. Die andere hingegen wurde nicht mehr benutzt, da sie inzwischen durch den Lagerzaun blockiert war. Als erstes stellte ich fest, dass die Toreinfahrt an ihrer Außenseite durch Stacheldraht gesichert war, dessen Überwindung aber kein Problem darstellte, da man die Rollen, dort wo sie die Seitenwand der Toreinfahrt berührten, zur Seite schieben konnte. Ich brauchte dies aber nicht zu tun, sondern hatte auch von meinem Platz hinter dem Draht genügend Sicht auf den etwa 12 Meter von der Einfahrt entfernt gelegenen Lagerzaun. Es gab am Zaun sogar einen toten Winkel, der von den Scheinwerfern der 60 – 80 Meter entfernten Türme nicht erreicht wurde. An dieser Stelle musste es gelingen, uns durch den doppelten Zaun zu schneiden. Das nötige Werkzeug dafür würde uns der Fluchtoffizier zur Verfügung stellen. Ich beobachtete noch eine Zeitlang das Verhalten der Posten in den Wachtürmen und stellte fest, dass Streifengänge entlang der Mauer in so großen Abständen erfolgten, dass wir in der Zwischenzeit den Zaun überwinden konnten. Sicher hatten wir die ganze Sache sehr positiv beurteilt und erst die nächste Nacht würde beweisen, ob wir uns nicht verkalkuliert hatten. So schlich ich dann nach geraumer Zeit wieder zurück, kletterte aufs Dach und wurde von Hannes Brix, der halb aus dem Fenster hing, hochgezogen und war wieder in Sicherheit. Nachdem ich meinen Lagebericht erstattet hatte, schliefen wir dem großen Tag entgegen, an dem das Unternehmen gestartet werden sollte.
Es sollte aber alles ganz anders kommen. Wir saßen gerade beim Frühstück als uns bedeutet wurde, aus dem Speisesaal direkt ins Freie zu gehen. Was das hieß, war uns bestens bekannt. Filzung im ungeeignetsten Augenblick. Wir begaben uns also nach draußen, fluchten über die Engländer und vor allem über den Lagerkommandanten, der bei uns nur unter dem Namen „Schottenröckchen“ lief. Es dauerte gar nicht lange, da wurde unsere Stubenbelegschaft reinzitiert und uns bedeutet, unsere Stube aufzusuchen. Wir wurden dort von einer aufgeregten Gruppe von Tommies erwartet, mit dem aufgebrachten „Schottenröckchen“ an der Spitze. Er hatte die eine Hälfte des durchgesägten Gitterstabs in der Hand und bellte uns an: „What is that?“ Ich erwiderte übertrieben höflich: „It seems to be an iron bar or part of it, Sir.” Er musste wohl den ironischen Beiklang in meiner Stimme wahrgenommen haben und war sichtlich verstimmt. Er beschuldigte uns, Eigentum seiner Majestät King George des V. beschädigt zu haben, Beweis: Der durchgesägte Gitterstab. Wir beteuerten natürlich unsere Unschuld; warum und womit sollten wir wohl einen so dicken Eisenstab zersägt haben. Es könnte ja auch ein Materialfehler vorliegen, oder frühere Bewohner unserer Stube hätten Seiner Majestät Staatseigentum beschädigt. Schottenröckchen wurde unser Geschwafel schließlich zu dumm und er befahl, uns sofort in den „Calaboose“ (Arrestzelle) zu bringen. So fanden wir uns dann zu je zwei in einer Arrestzelle des Zellentraktes wieder, der direkt unter dem Billardzimmer der Aufenthaltsräume der deutschen Offiziere lag. Das aneinanderstoßen der Billardkugeln war deutlich zu vernehmen, und wir schlossen Wetten ab, wer da wohl gerade gegen wen spielte. Wir hatten uns eben dieser neckischen Beschäftigung hingegeben, als wir aufgefordert wurden, die Zellen zu verlassen und im Zellengang anzutreten. Wir folgten dem Befehl provozierend langsam und lässig, mit den Händen in den Hosentaschen. Im Gang wurden wir von einer martialisch aussehenden Garde in Empfang genommen: Ein Sergeant und zwei Posten unter Gewehr mit Stahlhelm versehen eskortierten uns unter lautem: „left, right, left, right.“ Zum Allerheiligsten des Lagers, „Schottenröckchens“ Dienstzimmer. Im Vorzimmer des Allerheiligsten gab uns der Sergeant erst einmal Verhaltensmaßregeln, über das, was man nach Betreten des Zimmers des Lagerkommandanten erwarte. Einer von uns, ich glaube es war Wanne, sagte frech und arrogant, wie wir alle waren, zu dem belehrenden Sergeant: „We don`t need lessons in behaviour from an NCO,“ (Non-commissioned-officer = Unteroffizier). Wenn Blicke hätten töten können, wäre Wanne sicherlich in diesem Augenblick gestorben, man sah es dem Sergeant an, dass er sich nur mühsam beherrschte angesichts solcher Unverschämtheit.
Unter seinem lauten „left, right“ marschierten oder besser schlenderten wir in das Kommandantenzimmer, ein Posten an der Spitze und ein zweiter am Ende der Prozession. Wir nehmen in Linie zu einem Glied vor dem Schreibtisch des Kommandanten Aufstellung und dieser richtete nach einer zackigen Meldung des Sergeants seine strafenden Blicke auf uns und verurteilte uns nach den „Kings Regulation“ wegen Beschädigung von Government property zu je drei Tagen normalen Arrests, da wir dieses Deliktes hinreichend überführt seien, da die Schnittstellen an dem Gitterstab als frisch erkannt worden seien und somit wir Verursacher wären. Dann hieß es „rechts um“ und ab ging es zurück in unsere Zellen zum sofortigen Strafantritt. Die drei Tage saßen wir, wie es so treffend in Prisonerkreisen hieß, auf einer Backe ab. Wir verlangten allerdings energisch, dass man uns unsere Zahnbürsten, Handtücher und Seife sowie Rasierzeug bringen solle, da wir im Knast nicht vergammeln wollten. Man brachte es uns und außerdem wurde uns in den drei Tagen eine ausgezeichnete Verpflegung zuteil, denn es war eine Ehrensache für die deutsche Küche, dass Einsitzende Sonderrationen bekamen. So lebten wir besser als unsere Mitgefangenen in diesen drei Tagen. Als man am nächsten Morgen das Ansinnen an uns stellte, selbst unsere Zellen zu reinigen, machten wir auch der Wache klar, dass wir für einen deutschen „batman“ (Burschen) bezahlten und dieser unsere Zellen reinigen würde. Das wurde akzeptiert, und während wir unsere tägliche Auslaufstunde im Freien in einem anderen Käfig hatten, wurden die Zellen ausgefegt.
Die drei Tage vergingen im Fluge und dann nahm uns die Lagereinheit wieder unter ihre Fittiche. Wir mussten natürlich ausführlich berichten, wie es uns gelungen war, den Gitterstab durchzusägen. Wir genossen die Bewunderung, die man uns zollte, eitel, wie wir waren.
Die Tage vergingen, und wir überlegten, was wir noch anstellen könnten, um zu escapen. Aber, da das Lagerleben nicht nur aus escapen bestand und der neue deutsche Lagerführer, Oberst v. Hippel, viel Wert auf geistige und körperliche Betätigung der ihm Untergebenen legte, lernte ich erst einmal Kisuaheli und meldete mich bei unserem Theaterensemble, das unter der Leitung des damaligen Leutnants z.S. und späteren Fernsehstars Wolfgang Scheller stand. Warum Kisuaheli? Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht, weil die weiblichen Zöglinge der Kolonialschule in Rendsburg einen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen hatten, als sie uns Bettlaken schwingend grüßten, während wir als Kadetten mit der „Nürnberg“, einem leichten Kreuzer der deutschen Kriegsmarine, auf dem Nordostseekanal an ihrer Festung vorüberschipperten. Für eine tragende Rolle im Theater glaubte ich mich prädestiniert, weil ich beim Jungvolk schon in mehreren Laienspielen mitgewirkt hatte. Scheller ließ mich vorsprechen, akzeptierte mich und gab mir eine Rolle in „die Gans“, einem Lustspiel. Die anderen drei taten es mir gleich, soweit es die künstlerischen Ambitionen betraf. Hannes Brix glaubte, dass er besonders gute Anlagen für einen Stepptänzer besaß, und so fing er zu unserer Gaudi an, unter der Anleitung eines Profis herumzuhüpfen.
Man konnte ja in einem Offizierslager praktisch alles versuchen, da sich für fast alle Gebiete ein Experte fand. Dazu verfügten die Lager über reichhaltige Büchereien mit Stoff für jedes Fachgebiet.
Aber Bildung allein war es nicht, wonach wir lechzten; wir wollten raus aus dem Lager, frei sein und wenn auch nur für einige wenige Tage.
Es war inzwischen Spätherbst geworden. Spätherbst des Jahres 1943, in dem praktisch die Entscheidung über den Ausgang des Krieges gefallen war. Stalingrad, der nach dem Kriegseintritt der USA entscheidende Schlag gegen die Wehrmacht mit dem Verlust von fast 30 Divisionen. Dann der Untergang des Afrikakorps oder besser der Panzerarmee Afrika; die fehlgeschlagene Operation Citadelle und die Luftherrschaft der Alliierten, die zur systematischen Vernichtung der deutschen Städte führte. Das alles wussten wir, teils aus den englischen Rundfunknachrichten, teils aus der britischen Presse, die uns in großzügigem Maße zur Verfügung stand und last not least aus den Berichten von Neuankömmlingen, U-Bootfahrern und Fliegern, die Monat für Monat eintrafen. So erfuhren wir auch von dem Sterben der deutschen U-Bootwaffe, die von Dönitz nutzlos in den Tod getrieben wurde. Das wollten wir aber damals noch nicht wahrhaben. So unglaubwürdig es klingen mag, jeder von uns glaubte damals noch an den Endsieg. Was waren wir? Irre, verblendete Fanatiker, die vor der Wahrheit die Augen verschlossen oder sie verdrängten?
Da saßen wir nun sicher und gut aufgehoben in Nordengland, lebten, wenn man uns mit den armen Kerlen an der Front und in der Heimat verglich, in relativem Luxus und machten uns keine großen Gedanken über das, was sich jenseits des Kanals in Europa ereignete und dass unser Land im Begriff war, langsam aber sicher zugrunde zu gehen.
Es kam uns ganz gelegen und stärkte unser Selbstwertgefühl, als wir auf einer unserer täglichen Runden im Auslauf im Vorübergehen von Fröschel angesprochen wurden, Fröschel, dem König der Escaper, der uns jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit auf ein bestimmtes Zimmer bestellte. Wir kreuzten also dort zur verabredeten Zeit auf und befanden uns in guter Gesellschaft. Ein rundes Dutzend Offiziere war dort versammelt und der Fluchtoffizier machte uns mit einem Plan vertraut, der noch vor Weihnachten über die Bühne gehen sollte. Ein Tunnel sollte gegraben werden und das ganze Lager sollte in einer Nacht ausbrechen. Der harte Kern, einige Vier-Mann-Trupps, bestehend aus Offizieren aller drei Teilstreitkräfte, sollte versuchen, entweder von einem Flugplatz aus mit gestohlenen Maschinen oder von einem Hafen aus mit Booten die Insel zu verlassen, während der Rest in der Gegend ausschwärmen sollte, um die Suchmannschaften zu verwirren. Ein irrer Plan in jeder Beziehung und selbstredend waren wir Feuer und Flamme. Es sagte sich natürlich leicht: Wir bauen einen Tunnel und sind dann draußen. Die ganze Angelegenheit verlangte aber ein Ausmaß an Planung und Organisation, wie es sich ein Laie nicht vorstellen kann. Zunächst einmal musste eine Stelle gefunden werden, von der aus man den Tunnel beginnen konnte, ohne dass dies auch den auch während des Tages umherstreifenden Wachmannschaften auf den Türmen noch von anderen Personen außerhalb des Lagers eingesehen werden konnte. Zur Abstützung des Tunnels waren Bretter und Pfähle erforderlich, die mussten irgendwo organisiert werden, denn bei der englischen Lagerverwaltung konnten wir sie kaum erwerben. Last not least das größte Problem das Beseitigen der anfallenden Erdmassen beim Graben.
Wie lösten wir diese Probleme in Camp 15? Die Stelle, an der mit dem Bau des Tunnels begonnen werden sollte, war bald gefunden. Ein Seitenflügel des Gebäuderechtecks, in dessen Erdgeschoß sich die Küche des Lagers befand und in dessen erstem und einzigen Obergeschoß die Unteroffiziere und Mannschaften untergebracht waren, besaß natürlich auch eine Treppe. Diese Treppe war hinten und an einer Längsseite von Mauern des Erdgeschosses begrenzt, sodass Treppe und Mauern einen dreieckigen Raum bildeten, der an seiner Vorderseite durch eine Bretterwand abgeschlossen war. Man hatte in die Bretterwand eine Tür eingefügt, und so eine abgeschlossene Kammer gewonnen, die als Abstellraum dienen konnte. Durch intensive Beobachtung war festgestellt worden, dass diese Kammer anscheinend nicht genutzt wurde. Die Tür, die durch ein Vorhängeschloss gegen unbefugtes Eintreten gesichert war, galt es nun als erstes zu öffnen, ohne Spuren zu hinterlassen. Kein Problem für erfahrene Ausbrecher. Wie bei jeder Tür, die durch ein Vorhängeschloss gesichert werden soll, hatte man auch hier am Türrahmen ein Scharnier angebracht, dessen Rahmen an einer Platte festgeschraubt war, während die zweite, der Überwurf, über eine Platte gestülpt war, die mit einer Öse versehen, an der Tür festsaß. Am Schloß selbst konnten wir keinen Eingriff vornehmen. Da jedoch durch die eingerollten Ösen der beiden Scharnierplatten ein Stift gesteckt war, der die beiden Platten oder fachmännisch Lappen verband, ergab sich hier eine Möglichkeit, durch absägen eines der abgeplatteten Köpfe des Stiftes die Tür ohne sichtbare Einwirkung auf das Schloß zu öffnen. In der „Werkzeugkammer“ des Fluchtoffiziers befand sich auch eine kleine Metallsäge, die irgendein Prisoner bei irgendeiner Gelegenheit organisiert hatte, sodass das Absägen des unteren Stiftkopfes keinen großen Zeitaufwand erforderte. Wenn wir das Ding schon beim Durchsägen unseres Gitterstabs gehabt hätten, wäre uns viel Arbeit erspart geblieben. Dennoch erforderte die „Operation Stiftkopf“ ein ausgeklügeltes Überwachungssystem, um vor überraschend auftauchenden Schnüfflern (Wachpersonal) sicher zu sein. Da die Schnüffler ihre Runden im Gebäude von der Wachstube aus begannen, und diese nur durch eine einzige Tür mit dem eigentlichen Gefangenentrakt verbunden war, musste jeder Posten durch diese „hohle Gasse“ kommen. Die unauffällig bis zur Arbeitsstelle postierten Gefangenen gaben durch verabredete Zeichen sofort Alarm, wenn ein Wachmann unsere Interessenssphäre betrat.
So wurde in relativ kurzer Zeit der untere Stiftkopf abgesägt, zwei Mann verschwanden in der Kammer, und die Tür wurde hinter ihnen verschlossen. Sie inspizierten die Kammer eingehend und erstatteten dem Fluchtausschuß Bericht. Der Fußboden der Kammer war mit 50 x 50 cm großen Zementplatten abgedeckt, die man ohne Mühe von ihrer Unterlage lösen konnte, da sie nicht einzementiert waren. Vier Platten ergaben also ein Quadrat mit einer Seitenlänge von je einem Meter, was für das Graben eines senkrechten Stollens, der unmittelbar an der Mauer der hinteren Seitenwand hinabgetrieben werden sollte, ausreichte. Da die Mauern innerhalb eines Gebäudes erfahrungsgemäß nicht sehr tief in das Erdreich eingelassen waren, und der Seitenflügel keinen Keller besaß, wurde beschlossen, senkrecht nach unten zu graben und dann im rechten Winkel unter der Mauer hindurchzustoßen. Unmittelbar hinter der Mauer sollte dann ein größerer Arbeitsraum ausgehoben werden, von dem aus der eigentliche waagerechte Tunnel zu graben war. Das erste Stück des Tunnels bis zur Außenmauer würde dann unter der Küche verlaufen bis zur Außenmauer des Seitenflügels, eine Entfernung von gut 10 Metern. Dann sollte die Außenmauer durchbrochen werden – ein hartes Stück Arbeit – da sie aus soliden Natursteinen bestand. Einmal außerhalb des Gebäudes waren es weitere 12 Meter bis zum Doppelzaun, der uns von der Freiheit trennte. Einige Meter hinter dem Zaun fiel das Gelände steil ab, und hier sollte der Tunnelausgang, gedeckt von einer Buschgruppe, uns den Weg in die Freiheit ermöglichen. Punkt 1 und 2 unseres Planes konnten also abgehakt werden.
Ein Tiefbauspezialist, Pionieroffizier von Hause aus, gab uns aber unmissverständlich zu verstehen, dass wir für das Abstützen des Tunnels zumindest außerhalb des Gebäudes eine ganze Menge Bretter benötigen würden. Wo diese hernehmen? Wieder trat ein Braintrust zusammen, und man kam zu dem Schluß, dass man sich mal den Boden des Hauptgebäudes ansehen sollte, da ließe sich sicher das eine oder andere Brett oder die eine oder andere Latte aus dem Dachstuhl entfernen, ohne Gefahr zu laufen, dass der ganze Dachstuhl einstürzen würde. Gesagt, getan. Ein Erkundungskommando stellte fest, dass man den Boden am besten vom obersten Geschoß des Hauptgebäudes, in dem wir untergebracht waren, erreichen könnte. Boden und oberstes Geschoß waren jedoch nicht durch eine Treppe verbunden. Eine Luke in der Decke über dem Flur des Geschosses war die einzige Möglichkeit, auf den Boden zu gelangen. Die Luke war, wie konnte es anders sein, auch durch ein Vorhängeschloß, wie die Tür zur Kammer unseres Tunnelanfangs, gesichert. Es war also wieder die gleiche Methode anzuwenden, um das Schloß zu umgehen. Die Sicherung dieses Unternehmens war noch aufwendiger als die, beim Knacken der Tür. Aber auch Operation „Bodenluke“ ging glatt über die Bühne, und unser Pionier unterzog den Dachstuhl einer eingehenden Besichtigung. Das Resultat war erfreulich. Er teilte uns mit, dass wir eine ganze Menge Abstützmaterial dem Dachstuhl entnehmen könnten und als Bonus waren da noch die Dielen des Bodens, die sich hervorragend für unsere Zwecke eignen würden. Punkt 3 also auch abgehakt.
Punkt 4, das Verbringen des herausgegrabenen Erdreichs, bereitete uns mehr Kopfzerbrechen. Es gab eine ganze Reihe von Vorschlägen, die aber nach abwägen des Für und Wider verworfen wurden. Sie reichten vom Transport der Erde in Beuteln, die in den Hosenbeinen der Transporter versteckt, mit einem Zugverschluß versehen bei der Gartenarbeit auf den zu bestellenden Flächen entleert werden sollten, über Entsorgung mit Hilfe des Baches bis zum Runterspülen in den WCs. Schließlich hatte einer von uns eine grandiose Idee. Er hatte herausgefunden, dass sich zwischen dem Fußboden des Musikzimmers und der Decke des darunter liegenden Heizungskellers ein Hohlraum von ca. 50 cm Höhe befand, der sich über den ganzen Musikraum erstreckte. Da sich der Musikraum nur ca. 20 Meter von der Kammer, in der wir den Tunnelbau beginnen wollten, befand, wurde beschlossen, ein Stück aus dem Fußboden des Musikzimmers herauszusägen, aus den herausgesägten Dielenstücken eine Luke anzufertigen und auf das Ganze im Falle der Nichtbenutzung das Klavier als Tarnung zu stellen. So hatten wir fürs Erste einen Lagerraum für das Erdreich; daneben sollte aber auch in geringem Maße von den anderen Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden. So war zunächst auch Problem Nr. 4 gelöst, und nach Erstellung eines Arbeitsplanes konnten wir mit unserem Jahrhundertbauwerk beginnen. Wir beschlossen, während des ganzen Tages in Schichten zu je zwei „Diggern“ und Transporteuren zu arbeiten. Daneben war eine Anzahl von Sicherheitsposten erforderlich, die uns das Nahen von Schnüfflern ankündigen sollten.
Damit man die Digger nicht an ihrer verschmutzten Kleidung erkennen konnte, wurden Arbeitsanzüge in der Kammer bereitgelegt, und jeder Arbeiter hatte sich vor Arbeitsbeginn und nach den Schichten umzuziehen. Eine Kleinigkeit, die aber neben vielen anderen als nebensächlich erscheinenden Dingen ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens war. Ich arbeitete als Digger zusammen in einer Schicht mit Oberleutnant Winkler, einem Fallschirmjäger der Division Hermann Göring, dem ich nach dem Kriege noch einige Male bei der Bundeswehr begegnen sollte. Die Arbeit war hart und schweißtreibend; das Werkzeug primitiv und zum Teil selbst hergestellt. Aber wir machten Fortschritte. In kurzer Zeit konnten wir von der Arbeit in der Senkrechten in die in der Waagerechten übergehen. Das Unterqueren der Mauer hatte keine Schwierigkeiten bereitet und auch der Abtransport der Erde lief wie am Schnürchen. So gingen wir daran, hinter der Mauer einen bequemen Arbeitsraum einzurichten, von dem aus der Tunnelvortrieb begann. Da wir uns unmittelbar unter dem Fußboden der Küche befanden, konnten wir deutlich die Gespräche des Küchenpersonals während unserer Wühlarbeit hören. Sie bildeten gleichzeitig eine Geräuschkulisse, die unsere Arbeit tarnte. Das Prinzip unserer Arbeit war recht simpel. Der Mann vor Ort lag auf dem Bauch und füllte die Erde und was sonst noch anfiel in einen Kasten, der vorn und hinten mit einer Schnur versehen war. Der Mann im Arbeitsraum zog den vollen Kasten mit Hilfe der Schnur auf einer Gleitbahn bis in den Arbeitsraum und entleerte ihn in einen Sack, der von den Transportern je nach Lage weiter in den Musikraum befördert und dort ausgeschüttet wurde. Der leere Kasten wurde dann von dem Mann vor Ort mit Hilfe der vorn am Kasten angebrachten Schnur wieder an die Arbeitsstelle gezogen. Ein etwas mühsames Unternehmen, aber die aufgewendete Arbeitszeit, täglich 8 bis 10 Stunden machte sich im Laufe der Zeit doch bemerkbar, und wir erreichten nach harter Arbeit endlich die Außenmauer des Gebäudes. Hier begann der schwierigste Teil des Tunnelbaus mit dem Durchbruch der Mauer. Die Baustelle war inzwischen durch Experten mit dem aus dem Dachstuhl gewonnenen Material mit dem Fortschreiten der Arbeiten gesichert worden und hätte jeder Inspektion durch einen Grubenfachmann standgehalten.
Wir hatten sogar elektrisches Licht im Tunnel; das Kabel war in der Küche an die dort offen verlegte Leitung angeschlossen und durch den Fußboden in den Tunnel gezogen worden. Um den nötigen Sauerstoff im Tunnel zu gewährleisten, hatten wir aus Konservendosen eine Leitung gebaut, über die mit einem Blasebalg Luft in den Stollen gepumpt wurde.
Nun begann mit primitivem Werkezeug eine Arbeit, die uns endlos vorkam. Den ersten Feldstein aus der Grundmauer zu brechen, war eine Heidenarbeit. Stück für Stück wurde der Mörtel, der die Steine zusammenhielt, aus den Fugen gekratzt und geschabt, und der Fortschritt eines Tages waren im besten Falle Zentimeter. Deswegen wurde das Herauslösen des ersten Steins mit einem kleinen Fest gefeiert wie das Richtfest beim Bau eines Hauses. Das Herauslösen der weiteren Steine war bedeutend einfacher und so kam der Tag heran, an dem wir die Mauer bezwungen hatten. Ein Loch, groß genug, um sich hindurchzwängen zu können, war geschaffen, und wir konnten mit dem letzten Teil des Tunnelbaus beginnen, der Überwindung der Strecke von dem Gebäude bis hinter den Zaun. Es erwartete uns jedoch schon unmittelbar hinter der Grundmauer eine böse Überraschung. Wir stießen auf eine Unzahl von Steinen, die man wahrscheinlich beim Bau des Gebäudes zum Auffüllen der Baugrube verwendet hatte. Mühsam und Stück für Stück abstützend kamen wir nur langsam voran; aber wir machten Fortschritte und nur das zählte.
Während dieser Phase erhielt ich zu meiner großen Freude die erste Post von den Eltern und Rosemarie. Die Eltern hatten zuerst die Post aus Afrika und unmittelbar darauf meine erste Karte aus England erhalten und waren natürlich überglücklich, daß ich noch am Leben war. Viele Stellen in ihrem Brief waren jedoch vom Zensor unleserlich gemacht worden, denn wir sollten ja nicht erfahren, wie es mit der Moral in der Heimat bestellt war. In Rosemaries Brief war nichts gestrichen, anscheinend hatte die Zensur nichts gegen Liebesbriefe einzuwenden, wenn auch Rosemaries Brief nicht gerade ein Vulkan der Leidenschaft war. Aber sie war ja auch noch so jung, gerade 16 geworden, als wir uns das letzte Mal sahen. Außer einigen Knutschereien hatte sich noch nichts zwischen uns ereignet. „Reif werden und rein bleiben, das ist die schönste aber schwerste Lebenskunst“ hatte sie mir gesagt, als ich von ihr mehr als nur Küsse wollte. Was war mir übrig geblieben, als das zu respektieren? Nicht nur Briefe trafen von da an regelmäßig ein, sogar Pakete mit Lebensmitteln in Konserven und Zigaretten erhielt ich mindestens einmal im Monat. Sie liefen, glaube ich, über die Schweiz und Spanien nach Irland und gelangten von dort an ihren Bestimmungsort. Da Wanne, Hannes und Carsten auch Pakete bekamen, feierten wir mehrmals im Monat eine Freßorgie auf unserer Bude, und dachten nicht daran, daß man sich die Lebensmittel zu Hause sicher vom Mund abgespart hatte. Meine Konserven waren sehr begehrt, da ihr Inhalt meistens aus Wildschwein und Reh bestand, gestiftet von Jagdfreunden meines Vaters.
Doch zurück zum Unternehmen „Tiefbau“. Es war an einem der ersten Tage im Dezember. Wir hatten uns schon gut vier Meter vom Gebäude auf den Zaun zugewühlt, als unser Unternehmen durch eine kleine Unachtsamkeit in die Binsen ging. Winkler und ich waren gerade auf Schicht und arbeiteten uns verbissen Zentimeter um Zentimeter vorwärts, als plötzlich die Verbindung zu den Transporteuren abriß. Ich hatte gerade einen Sack voller Erde zum Abtransport fertiggemacht und wollte ihn in den Schacht bringen, als vor der Tür der Kammer großes Geschrei anhub. Ich verschwand sofort aus dem Schacht in den Arbeitsraum, hörte dort, wie die Tür geöffnet wurde und vernahm aufgeregte englische Stimmen, die angesichts des offenen Schachts die bloody prisoners verfluchten. „Get the commandant at once!“ befahl jemand und Schottenröckchen war in kurzer Zeit zur Stelle. Winkler war inzwischen zu mir in den Arbeitsraum gekrochen, wir sahen uns an und sagten beide fast gleichzeitig: „Verdammte Scheiße, jetzt war die ganze Schufterei für die Katz!“. Dann vernahmen wir Schottenröckchens Stimme, der uns mit den Worten: „Come out!“ aufforderte, den Tunnel zu verlassen und uns an das Tageslicht zu begeben. Voller Wut über die Entdeckung des Tunnels schrie ich zurück: „Come and get us!“. Niemand schien sich jedoch zu trauen, in den engen Schacht hinunterzuklettern. So verging eine geraume Zeit; dann wurde es uns zu blöd, weiter wie eine Maus in der Falle zu sitzen und auf die Katze zu warten und wir machten uns auf den Weg nach oben. In der Kammer wurden wir von Wachmannschaften mit gezogenem Revolver und von Schottenröckchen erwartet. Wir wurden zunächst in das Wachlokal eskortiert, dann wollte Schottenröckchen von uns Einzelheiten über den Tunnel wissen. Wir brachten ihn mit dem Hinweis, dass wir den Tunnel zur Besichtigung freigäben und er eine Ortsbesichtigung vornehmen könne, vollends auf die Palme. Er ließ uns dann nach draußen vor den Gebäudeflügel führen, aus dem der Tunnel ins Freie führen musste, und befahl, mir einen Spaten zu geben. „Dig it out!“ schnauzte er mich an. Als der Sergeant mir den Spaten reichen wollte, verschränkte ich meine Arme hinter dem Rücken, und während der Spaten zu Boden fiel, schaute ich den Kommandanten an und sagte: „Sir, I am a German Midshipman, and I am not supposed to work whilst beeing a POW!“ Er lief gefährlich rot an und bellte zum Seargant: „Lock him up, I will see him later in my office!” Ab ging es im Geschwindschritt zu dem mir nicht mehr unbekannten Zellentrakt. Wenig später tauchte auch Oberleutnant Winkler auf, mit dem man das gleiche Spielchen versucht hatte. Winkler hatte das Ersuchen, höflich aber bestimmt mit dem Verweis auf seinen Offiziersrang abgelehnt. Während wir zusammen in der Zelle hockten, zermarterten wir uns das Gehirn, wie die Briten wohl unsere Baustelle entdeckt haben konnten. Sehr viel später nach der Verbüßung unserer Strafe brachten wir es in Erfahrung. Eine winzige Kleinigkeit hatte unser Vorhaben scheitern lassen. Beim Abtransport der Erde muß ein Transportsack ein Leck gehabt haben, durch das die Erde herausrieselte und damit eine für geschulte Wächteraugen nicht übersehbare Spur hinterließ. Unglücklicherweise war einer der Briten aufgekreuzt, ehe die verräterische Spur beseitigt werden konnte. Er war ihr gefolgt bis sie vor der Tür zur Kammer endete, hatte sofort Alarm gegeben und so war unser genialer Plan gescheitert, nachdem man das Schloss der Kammer geöffnet und den Tunneleingang entdeckt hatte. In den Tunnel ist wohl keiner der Briten je gekrochen. Sie schütteten den Eingangsschacht und den außerhalb des Gebäudes gegrabenen Hohlraum einfach zu. Das war sicher ein Fehler, denn das Tunnelstück unter der Küche stand damit für weitere Vorhaben immer noch zur Verfügung.
Es dauerte aber gar nicht lange, bis unserer Unterhaltung ein Ende gesetzt wurde. Wie gehabt wurden wir beide von einer Eskorte abgeholt und zum Kommandanten geführt. Da wir jede Aussage verweigerten, wurden wir wegen Beschädigung von Staatseigentum und ungebührlichen Benehmens gegenüber dem Kommandanten zu den hierfür üblichen 28 Tagen Arrest verurteilt. Die hätten wir sicher auf einer Backe abgesessen, aber Schottenröckchen hatte unser freches Auftreten nicht gefallen, und so verschönerte der „rachsüchtige alte Hund“, wie wir ihn von nun an nannten, unseren Arrest, indem er uns zu „28 days detention, water and bread only“ verdonnerte. Ganz so schlimm, wie sich das anhört, war es aber nicht, denn nach jedem zweiten Tag bei Wasser und Brot erhielten wir am dritten Tag volle Rationen. So bekamen wir also zwei Tage lang viermal täglich einen Krug klares Wasser und einen Stapel von Weißbrotschnitten. Richtig satt wurde man davon allerdings nicht, aber man fiel auch nicht vom Fleisch, denn der dritte Tag hatte es in sich. Da wir unsere Verpflegung auch diesmal von der deutschen Küche bekamen, wurden wir an den dritten Tagen richtig verwöhnt und setzten sicher dabei wieder das Gewicht an, das wir an den beiden kargen Tagen eingebüßt hatten. Der Nachmittagskaffee an einem „Tag der vollen Ration“ wurde zu einer großen Überraschung für mich. Neben einer Kanne Kaffee erhielt ich ein ungewöhnlich großes Stück Kuchen, das mit einer dicken Glasur überzogen war. Als ich heißhungrig hineinbiß, fühlte ich etwas zwischen den Zähnen, was mit Kuchen nichts gemein hatte. Ich zerteilte also den Kuchen und fand darin eine kleine Packung Zigaretten „Wild Woodbines“, dazu Zündhölzer und eine Reibefläche, ferner einen Zettel von Wanne und Hannes Brix, die mir folgendes mitteilten (den Zettel habe ich heute noch und hüte ihn wie einen Augapfel): Zunächst Wanne im Original: „Mein lieber, alter Will! Hier im großen und ganzen alles beim alten. Neuigkeit lediglich Unteroffizier Gnüchtel (der bereits erwähnte Focker Wulf 200 Flieger) auf unserer Stube. Umbelegung haben wir Adjutanten, diesem seltenen Rübenschwein zu verdanken. Schottenröckchen hat sich nun auf die Socken gemacht. Neuer Kommandant läßt unbedingt auf semitische Vorfahren schließen. Weiß nicht, ob du schon die Ehre hattest, ihn kennenzulernen. Carsten ist noch nicht hier (Er war im Lazarett) jedoch ist im Laufe des Monats mit seinem eintrudeln zu rechnen. Wird auch Zeit, daß wir endlich wieder vollzählig sind. Zwei Päckchen sind in der Zwischenzeit auch für dich angekommen, schätzungsweise Konserven. Zigaretten sind auch da, Du kannst also anschließend mal unanständig luxuriös leben. Wünsch dir für die letzte Woche des unfreiwilligen Aufenthalts Hals- und Beinbruch. Falls dies Ding hier entdeckt wird, werde ich ja wohl Gesellschaft leisten können. Heil und Sieg! Dein Wanne.“ Und nun Hannes Brix: „Will, alter Kumpel! Wanne hat dir das wichtigste ja schon geschrieben. Zu bemerken wäre vielleicht noch, daß Silvester und die „Gans“, deine Vertretung übernahm! Tagtäglich springe ich dir jetzt auf dem Kopf herum, lerne steppen. Post habe ich schon zweimal erhalten. Drei Briefe, all is well. Zu guter Letzt habe ich Do-Ko gelernt, tadellos. Du bekommst doch auch deine Briefpost? Zum englischen Kommandantenwechsel hat sich auch in den Pöstchenbesetzungen der deutschen Führung einiges geändert. Kantine blieb Hauptmann M. Dagegen ist Hausoffizier Olt. Georg, Hauptmann Vorsteher Rot Kreuz Offizier usw. Du weißt, daß wir in Gedanken immer bei Dir sind. Auch die letzte Woche wird vorbeigehen. In diesem Sinne Heil und Sieg! Hannes.“
Wir saßen also bereits drei Wochen im Bau. Das Weihnachtsfest hatten wir in der Zelle verbracht. Sowohl Winkler als auch ich bekamen einen kleinen Weihnachtsbaum, einen künstlichen, wie sie das Rote Kreuz den Lagern in England hatte zukommen lassen. Wir durften sogar die kleinen Kerzen anzünden und hatten uns gerade am Heiligen Abend einer trüben Stimmung hingegeben, als wir über unseren Köpfen im Billardsaal lautes Fußgescharre vernahmen und dann ganz deutlich deutsche Weihnachtslieder hörten, die der deutsche Lagerchor für uns sang. Wir waren ehrlich gerührt. Nach dem Gesang ein dröhnendes: „Frohe Weihnachten, Ihr da unten“, dann Auszug der Sängerknaben und wieder Stille.
Nun schrieben wir also das Jahr 1944. Fast ein Jahr war seit meiner Gefangennahme vergangen, ich hatte meinen ersten Geburtstag, an dem ich 20 wurde, und das erste Weihnachtsfest in Gefangenschaft hinter mir und es war nicht abzusehen, wie viele noch folgen würden, ehe wir wieder freie Menschen sein würden. Aber noch saßen wir in unseren Arrestzellen in Einzelhaft. Winklers Zelle war unmittelbar neben meiner gelegen, so daß wir uns, wenn einer das Ohr an die Zellenwand preßte und der andere laut genug gegen die Wand sprach, verständigen konnten. Das war wichtig, denn es gibt nichts Schlimmeres für einen Gefangenen als die Einzelhaft. Wenn man mit keinem reden kann, wird einem der Tag zur Ewigkeit und man glaubt, wahnsinnig zu werden. Obwohl die Verständigung nicht die beste war, genügte sie aber doch, um „Schiffe versenken“ und „Städte raten“ spielen zu können und uns so die Zeit zu vertreiben. Trotz dieser Spielchen, bei denen nicht geschummelt wurde, was mir schwerfiel, und trotz der Bücher, die wir von der Lagerbücherei bekamen, waren die vier Wochen dennoch eine verdammt lange Zeit, die nicht enden wollte. Ein Tag verlief so monoton wie der andere. Es begann mit dem Wecken, dann wurden wir zu dem Waschraum und zur Toilette geführt. Danach Frühstück in der Zelle, gefolgt von der besten Stunde des Tages, dem Auslauf an der frischen Luft in dem schon erwähnten Käfig. Der Rest der Stunden verging mit Spielen, Lesen und Essen. Während unseres Auslaufs wurden unsere Zellen gefegt und gewischt. Diesmal hatte man gar nicht das Ansinnen an uns gestellt, diese Tätigkeit zu verrichten, sondern gleich unsere Aufklarer geschickt. Es gelang uns aber nur selten, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, denn meist waren sie schon wieder verschwunden, wenn wir von unserem Morgenlauf zurückkamen. Bei einem dieser Kontakte gaben wir ihnen zu verstehen, daß wir künftig Nachrichten an das Lager hinter dem Klo zur Weiterleitung verstecken würden. Das funktionierte auch einige Male, aber dann kamen die Posten dahinter und die Verbindung war abgerissen, bis die Kumpel im Lager auf den Trick mit dem Kuchen kamen. Dumm war nur, daß man uns bei Tage die Matratzen der Pritschen aus den Zellen holte, und wir nur die Wahl zwischen dem Sitzen auf dem Stuhl oder dem Liegen auf der Drauflage für die Matratze hatten. Das Ruhen auf dieser Drauflage war jedoch so unbequem, daß man es nicht lange aushielt und Striemen auf Rücken und Po davontrug. Es gab natürlich noch die dritte Möglichkeit, in der Zelle auf und ab zu gehen wie ein Tiger in seinem Käfig. Aber wir bereuten es nicht, an der Tunnelbuddelei teilgenommen zu haben. Wer sich an Fluchtvorbereitungen beteiligte, akzeptierte das Risiko, erwischt zu werden mit den bekannten unangenehmen Begleiterscheinungen. Wer ausbrach nahm das Risiko in Kauf, auf der Flucht erschossen zu werden, obwohl dies im anglo-amerikanischen Bereich nur sehr selten geschah. Aber es geschah.
Wir hatten in den vier Wochen viel Zeit und Muße, über neue Fluchtpläne zu brüten, denn eins war klar: Wir würden es immer wieder versuchen. Während unseres täglichen Auslaufs nahmen wir auch, vielleicht zum ersten Mal, die Landschaft, in der Shap Wells Hotel lag, wirklich zur Kenntnis. Es war eine trost- aber nicht reizlose Gegend. Eine Art Hochmoorgebiet, dessen einzige Bewohner Schafe zu sein schienen, die große Ähnlichkeit mit unseren Heidschnucken hatten. Ab und zu war die hügelige, von Umfriedungen aus Feldsteinen durchzogene Gegend von einem kleinen Wäldchen unterbrochen. Es war eine Landschaft, die dazu beitrug, trübsinnig zu werden und Depressionen zu bekommen, wenn man sich zur sehr mit ihr befasste. Uns POWs interessierte sie aber von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus. Wie geeignet war sie zur Flucht, wo konnte man sich verstecken? Und damit war es nicht sehr gut bestellt. Man musste sie schnell durchqueren, um im Schutz der Wälder des Lake Districts unterzutauchen. Aber erst mußte man ja mal aus dem Lager herauskommen, und das war eben nicht einfach.
Schließlich waren die vier Wochen Arrest vorüber und das Lager hatte uns wieder. Wir wurden von unseren Kameraden mit großem Hallo empfangen und genossen den Ruhm und die relative Freiheit nach dem Eingesperrtsein in der Zelle.
Wanne und Hannes hatten inzwischen eine neue Behausung bezogen, da die alte mit dem zersägten Gitter, das man natürlich längst wieder in Ordnung gebracht hatte, von einer anderen Crew belegt worden war. Als gefährliche Troublemaker hatte man ihnen ein Zimmer im ersten Obergeschoß mit Blick auf die Liegewiese und den Auslauf zugewiesen, dessen Fenster im Erfassungsbereich der auf den Türmen angebrachten Scheinwerfer lag, so daß eine Flucht aus den Fernstern unmöglich war.
Ich lernte auch unseren neuen Stubengenossen, Uffz. Gnüchtel kennen, der mir bestätigte, einen Angriff mit einer Condor auf das Geleit geflogen zu haben, mit dem ich von Afrika nach England gebracht worden war. Er war ein patenter Kerl, der gut in unsere Stubengemeinschaft passte.
Der erste Tag unserer relativen Freiheit endete mit einer Party auf unserer Bude, bei der der Inhalt der inzwischen für mich eingetroffenen Pakete verspeist wurde. Die Bude, die wir nun bewohnten, war geräumiger als die alte, und ein freischaffender Künstler hatte die eine Wand mit einem etwas kitschigen Bild verschönt. Nausikaa am Gestade, natürlich oben ohne und das fast in Lebensgröße. Das Gemälde hatte nach seiner Vollendung missbilligende Kommentare der puritanischen Briten provoziert und war sogar von unserem Lieblingsseargant als „obscene“ bezeichnet worden. Wir fanden es aber gut, war es doch das einzig Weibliche, was es im Lager gab. Auch einen Vorteil hatte die neue Behausung. Sie enthielt ein wunderbares Versteck für Sachen, die unbedingt den Augen der Briten verborgen bleiben mussten, wenn diese mal wieder eine ihrer unvorhersehbaren Filzungen durchführten. Um die Wand vor Spritzern des Waschbeckens, daß wir in dem Zimmer besaßen, zu schützen, war unmittelbar hinter und über dem Waschbecken die Wand mit einer 1m x 1m großen Platte aus Marmorimitat abgedeckt. Sie wurde durch Schrauben mit der Wand verbunden und, um das ganze vornehmer erscheinen zu lassen, waren die Schraubenköpfe mit einer Verkleidung versehen. Findig hatten wir festgestellt, dass sich zwischen den Trennwänden der einzelnen Zimmer ein Hohlraum befand. Es war nun ein Leichtes, die Platte abzuschrauben, die Wand aufzustemmen und so hinter der Platte ein filzungssicheres Versteck für Werkzeug, Karten, selbstgenähte britische Uniformstücke und vieles andere anzulegen. Die Bewacher haben dieses Versteck nie aufgespürt.
Wir überprüften auch den Kamin auf seine Verwendbarkeit als Fluchtweg. Er war aber ungeeignet, da der Schacht mehrere gemauerte Züge hatte, die mit Bordmitteln einfach nicht zu beseitigen waren und selbst im Erfolgsfall wären wir lediglich auf dem Dach des Gebäudes oder im Erdgeschoß gelandet. Um dahin zu gelangen, standen uns einfachere Wege offen.
Mitten in unsere Überlegungen über neue Fluchtmöglichkeiten platzte eine Bombe. Die Flucht von zwei Offizieren, denen es gelang, aus dem Lager auszubrechen. Die Flucht war sorgfältig vorbereitet worden. Nur der Fluchtoffizier und sein Komitee waren eingeweiht. Man hatte eine Möglichkeit ausfindig gemacht, durch ein vergittertes Küchenfenster ohne Schwierigkeiten in den Innenhof zu gelangen. Da sich im Innenhof auch die Garagen für den bescheidenen Fuhrpark des Lagers befanden, hatten die beiden Fluchtaspiranten vorgeschlagen, sich als Engländer verkleidet in den Besitz des Krankenwagens zu bringen und mit diesem einfach durch das Lagertor in die Freiheit zu fahren. Es war schon öfter vorgekommen, dass nachts Krankentransporte durchgeführt werden mussten, und man hatte festgestellt, dass der Torposten die Insassen des herausfahrenden Krankenwagens nie kontrollierte. Es wurde damit gerechnet, daß die Chancen für das Gelingen dieses abenteuerlich erscheinenden Planes größer waren, wenn die Flucht nach dem Abend-Roll Call über die Bühne ging, da man dann in Bewacherkreisen die Germans wohlverschlossen in ihren Zimmern wähnte. Die beiden Ausbrecher sollten schon während des Roll Calls in der Küche versteckt werden, die unmittelbar vor demselben abgeschlossen wurde und für keinen mehr zugängig war. Ihre Stelle bei der Zählung, die zu dieser dunklen Jahreszeit im Flur des Hauptgebäudes stattfand, sollten zwei als Prisoner verkleidete Puppen einnehmen. Diese Puppen sollten dann auch beim anschließenden Verschluß der Zimmer in die Betten der Ausbrecher gelegt werden um diese „zu ersetzen“. Der Plan klappte fantastisch. Die Dummies fielen weder beim Roll Call noch beim Stubenverschluß auf, und auch der zweite Teil des Unternehmens, die Fahrt mit dem Krankenwagen aus dem Lager heraus, ging ohne Zwischenfall über die Bühne. Erst Stunden später, als die beiden Ausbrecher das Fahrzeug längst gut getarnt in einem einsamen Feldweg im Schutz einer Hecke abgestellt und bereits weit vom Lager entfernt zu Fuß den nächtlichen Lake District erreicht hatten, war man bei der Torwache unruhig geworden, weil zwar die Wegfahrt des Krankenwagens notiert worden war, dieser aber ungewöhnlich lange wegblieb. Die Torwache checkte das schließlich mit der Fahrbereitschaft, und da war die Fahrt des Wagens natürlich nicht angemeldet worden. Auch bei dem für das Lager zuständigen Hospital war er nicht eingetroffen. Die Alarmsirene ging los, wir wurden unsanft aus dem Schlaf geschreckt und unsere Anwesenheit in den Zimmern überprüft. Man fand die beiden Ausbrecher nicht in ihren Kojen, wohl aber die Puppen. Der britische Kommandant hatte, ganz im Gegensatz zu Schottenröckchen, viel Verständnis für einen guten Coup. Seine einzige Bemerkung gegenüber dem deutschen Lagerkommandanten, den er in sein Büro zitiert hatte, lautete: „Clever chaps, good job, but they will not get away.“ Er sollte Recht behalten, der Traum von der Freiheit war für die beiden Ausbrecher nach ein paar Tagen zu Ende geträumt. Man erwischte sie auf einem Güterzug nach Süden. Da es ihnen, des Marschierens müde – sie kamen beide von der Luftwaffe – nicht gelungen war, in einen der geschlossenen Waggons zu gelangen, hatten sie sich sinnigerweise auf den Puffer eines Güterwagens gesetzt und waren so bei der Durchfahrt durch einen Bahnhof von einem Bahnbeamten entdeckt worden. Bereits an der nächsten Haltestelle wurden sie von einer bewaffneten Ehrengarde erwartet und in Gewahrsam genommen. Glücklicherweise hatten sie die englischen Uniformstücke gleich nach Verlassen des Krankenwagens gegen deutsche gewechselt, sodass man ihnen den Vorwurf des Tragens britischer Uniformen nicht anlasten konnte. Das hätte im schlimmsten Fall Tod durch Erschießen bedeuten können.
So kamen die beiden wieder zurück und wanderten für 28 Tage in den Bau, die sie aber nicht vollständig absitzen mussten. Warum? Davon später. Es braute sich bereits das nächste Gewitter zusammen. Wir hatten in der Zwischenzeit einen neuen Fähnrichsoffizier bekommen, Kaleu Burkhart Hackländer, Kommandant U-454, der im Nordatlantik abgesoffen war. Ein feiner Offizier, der viel Zeit darauf verwandte, unsere magere Halbbildung zu verbessern und uns damit tödlich langweilte. Denn wir hatten andere Interessen, als uns ausgerechnet mit den Klassikern der deutschen Literatur zu beschäftigen. H. war zu Beginn des Krieges auf Zerstörern gefahren und hatte das Zerstörerfiasko in und vor Narvik mitgemacht. Nachdem auch der letzte der zehn deutschen Zerstörer untergegangen war, hatten die Bootsbesatzungen zusammen mit Soldaten des Heeres unter Dietl, und unterstützt durch die Luftwaffe, den Raum um Narvik gehalten, bis die operative Lage in Norwegen die Alliierten zwang, sich aus Nordnorwegen zurückzuziehen. „Hacki“, wie er bei uns Subalternen hieß, verstand es, sehr spannend über diese Kämpfe zu berichten. Aber, da die Wiederholung selbst die spannendste Story tötet, folgten wir seinen Ausführungen nach der zehnten Wiederholung nicht mehr sehr interessiert, und als dann die zwölfte Wiederholung fällig war, unterbrachen wir ihn mit dem Gesang: „Und wieder hat`s zum zwölften Mal geklingelt!“ Hacki fand das gar nicht lustig und strafte uns zunächst mit Verachtung. Da kam uns wieder einmal unerwartet Fröschel zur Hilfe. Er sprach Hannes und mich beim Rundendrehen im Auslauf an und fragte, ob wir zusammen mit ihm und Leutnant Loosen die bessere Luft jenseits des Zaunes schnuppern wollten. Uns konnte gar nichts schöneres geschehen, denn so konnten wir der pädagogischen Berieselung durch H. entgehen, ohne ihn weiterhin durch schlechtes Benehmen unsererseits zu verletzen. Bruno Loosen hatten wir schon vorher kennen und schätzen gelernt. Er war als Jagdflieger im Mittelmeerraum vom Himmel geholt worden und einer der jungen Leutnants, die sich mehr zu uns als zu den älteren Offizieren hingezogen fühlte. Er kam später bei der Bundesluftwaffe zu hohen Ehren und wurde als Generalleutnant Befehlshaber des Luftflottenkommandos, also oberster Chef aller fliegenden Verbände der Luftwaffe der BRD. Ich sollte ihm während meiner Bundeswehrzeit des Öfteren begegnen. Bemerkenswert erscheint mir auch, dass er nach der Gefangenschaft Kontakt mit Hannes Brix hielt und schließlich dessen Schwester heiratete.
Fröschel entwickelte uns seinen Plan, der natürlich wie alle seine Pläne einen Hauch von Wahnsinn enthielt. Wir vier wollten vor dem Abend-Roll Call durch das bewußte Küchenfenster über den Innenhof und das mir sattsam bekannte hintere Tor den Zaun erreichen und ihn überwinden. Das klang alles ganz einfach; wir vertrauten darauf, dass die Posten auf den Türmen nicht damit rechneten, daß jemand so verrückt sein könne, einen Fluchtversuch zu dieser Tageszeit und an diesem Ort zu wagen. Wir hatten uns aber im wahrsten Sinne des Wortes noch eine Hintertür offen gelassen für den Fall, daß das Unternehmen in die Hose gehen sollte. Von der Küche aus führte eine Tür an der Seite des Gebäudes, an der unser Fluchtweg lag, ins Freie. Findige Leute hatten es geschafft, das Schloß dieser Tür bei Bedarf schnell mit einem Dietrich zu öffnen. Wir hatten uns ausbedungen, daß man die Tür in dem Augenblick aufschließen sollte, an dem wir durch das Fenster in den Innenhof stiegen. Zur Not konnten wir dann in einem geschlossenen Sprung durch die Tür wieder in die Sicherheit des Gebäudes gelangen.
So ging auch dieses Unternehmen eines Abends dann wie geplant über die Bühne. Wir hatten keine Schwierigkeiten in den Innenhof zu gelangen, diesen zu passieren, und durch das Tor den Raum zwischen Gebäuderückseite und Zaun zu erreichen. Im Schutz des Schattens robbten wir an der Gebäuderückseite entlang, kamen an unserem Noteingang, der Küchentür vorbei und machten uns dann via Holzhof auf den Weg zum Zaun. Der Holzhof, auf dem zersägte Stämme für die Heizung lagen, bot zwar keine ideale aber immerhin ausreichende Deckung als Zwischenziel. Von dort waren es noch gut 12 Meter bis zum Zaun und der Stelle, die wir für seine Überwindung ausgesucht hatten. Umgegrabene Beete und ein Beet mit Grünkohl des Küchengartens verhießen weiterhin einen Hauch von Deckung auf den letzten Metern.
Aber das Pech wich uns auch diesmal nicht von der Seite. Während wir im Schutz der Stämme Atem holten, wurde von einem der Türme ein Scheinwerfer auf den Holzhof gerichtet, und da lagen wir regungslos in seinem gleißenden Licht. Es war einfach nicht möglich, auch nur einen Meter weiterzurobben, ohne entdeckt zu werden. Fröschel zischte uns zu: „Abwarten!“ So lagen wir da, wie Kaninchen vor einer Schlange, unfähig, uns zu rühren. Wie lange wir so verharrt hatten? Es kam uns wie eine Ewigkeit vor, aber in Wirklichkeit war es nur eine halbe Stunde. Die Zeit des Roll-Calls rückte immer näher und an unserer miserablen Lage änderte sich nichts. So beschloß Fröschel, dass wir das Unternehmen abbrechen mußten. Auf sein Zeichen sprangen wir auf, rasten zur Küchentür und in das Gebäude hinein, begleitet von den aufgebrachten Halt-Schreien der Posten. Sie kamen aber nicht dazu, auch nur einen einzigen Schuß abzufeuern; wie der Blitz waren wir verschwunden und in unsere Zimmer geeilt, wo wir uns im Affentempo umzogen und die Fluchtklamotten in unserem Safe hinter dem Waschbecken unterbrachten. Die Briten orderten sofort eine Zählung der Prisoners an, und siehe da, es fehlte nicht ein Schäfchen. Ihr einziger Erfolg war, festzustellen, daß die Küchentür nicht astrein war, und sie wurde nun so gesichert, daß sie für künftige Fluchtunterstützung nicht mehr in Frage kam. Wer sich da draußen herumgetrieben hatte, bekamen die Briten jedoch nie heraus. Befragungen wurden nach kurzer Zeit als „waste of time“ eingestellt.
Es war wirklich zum Kotzen. Nun war bereits mein dritter Versuch, das Lager zu verlassen, gescheitert. Also auf ein Neues. Einmal würde auch mir Fortuna hold sein. Die Fortsetzung des Tunnelprogramms wurde ernsthaft in Erwägung gezogen. Man plante, diesmal in der Küche zu beginnen und den noch vorhandenen Teil des Tunnels einzubeziehen. Dieses Projekt kam aber über das Planungsstadium nicht hinaus. Der Grund: Verlegung nach Kanada. Die Verlegung nach Kanada kam für uns alle wie ein Blitz aus heiterem Himmel, obwohl es jedem klar sein mußte, dass wir früher oder später den Weg in das gelobte Land der Holzfäller antreten würden. Zum einen hatte man auf der Insel nicht Platz für eine unbegrenzte Zahl von Kriegsgefangenen, zum anderen stellten sie ein nicht unerhebliches Versorgungsproblem dar, denn die Briten lebten aufgrund der knappen Tonnage auch nicht eben wie die Made im Speck, und jeder zusätzliche Esser war eine Belastung. Darüber hinaus stand 1944 die Invasion in Frankreich vor der Tür, und die anfallenden Kriegsgefangenen würden zumindest in den ersten Phasen dieser kriegsentscheidenden Operationen nach Großbritannien gebracht werden müssen.
So wurden wir in einer Februarnacht des Jahres 1944 unsanft durch Sirenengeheul und aufgeregtes Schreien der Wachmannschaft aus dem Schlaf geschreckt und mussten sofort im Hauptkorridor des Gebäudes antreten. Hier wurde uns eröffnet, daß wir unsere Sachen zu packen hätten und in zwei Stunden das Lager verlassen würden. Man sagte uns natürlich nicht, daß uns eine Seereise nach Kanada bevorstand.
Uns blieb gerade noch genug Zeit, um einigen Mannschaftsdienstgraden, die im Lager zurückbleiben sollten, unseren Safe mit den wertvollen Fluchtutensilien zu zeigen, dann war es soweit, daß wir stubenweise abgerufen wurden, um im Hof wartende Lkws zu besteigen. Auf dem Hof begegnete uns unser Lieblingssergeant, den wir den „Oberschnüffler“ nannten. Er grinste mich an und sagte: „No more escaping, Rahn!“ Ich entgegnete: „Wait and see!“
Dann waren wir mit unseren Seesäcken draußen, bestiegen einen Lkw, und ab ging die Fahrt in den dämmernden Morgen; wohin? Keiner hatte einen Schimmer, aber erfahrene POWs waren sicher, daß wir, da die Fahrt nach Norden ging, in Glasgow zur Verschiffung nach Kanada landen würden. Die Lkw-Fahrt war aber rasch zu Ende. Wir hielten auf einem Bahnhof, ich glaube es war Kendal, und dort in einen schon wartenden Zug. Mit dem Besteigen des Zuges wurde für uns Fähnriche und Oberfähnriche das Wirklichkeit, was schon lange wie ein Damoklesschwert über uns geschwebt hatte: Das Ende des Komforts und der Privilegien eines Offizierlagers. Seit Wochen waren Bemühungen im Gange, Fähnriche und Oberfähnriche aus dem Gefüge der Offiziere herauszulösen und sie wie Portepeeunteroffiziere einzustufen. Der Grund dafür ging, wie man dem deutschen Lagerführer bedeutete, von Vorgängen in deutschen Offizierlagern aus. Irgendein Tölpel war auf die gloriose Idee gekommen, alliierte Warrant Officers, eine Rangklasse zwischen Offizieren und Unteroffizieren, aus den Offizierslagern in Mannschaftslager zu stecken, weil diese besonders in den Besatzungen abgeschossener Flugzeuge in immer größerer Anzahl anfielen. Das hatte sich natürlich schnell bei den Briten herumgesprochen, und es war nur allzu menschlich, daß sie nun mit den Deutschen gleichziehen wollten. Was lag also näher, als die Fähnriche und Oberfähnriche in die Mannschaftslager zu schicken? Durch den Widerstand der deutschen Lagerführung hatte sich das bisher jedoch in Camp 15 nicht gravierend ausgewirkt. Man hatte uns zwar einen Unteroffizier auf unser Zimmer gesteckt, und wir mußten bei den Roll Calls abgesetzt von den Offizieren und Unteroffizieren zwischen diesen Aufstellung nehmen. Das hatte uns jedoch wenig gejuckt, solange man uns nicht in ein reines Mannschaftslager schickte.
Nun war die günstige Gelegenheit gekommen, den Schnitt zu vollziehen. Wir fanden uns wieder in einem Eisenbahnwagen, der für Mannschaften und Unteroffiziere bestimmt war, und damit sagten wir für den Rest unserer Gefangenschaft der Polsterklasse ade und fanden uns in der Holzklasse wieder. Das brachte natürlich einige einschneidende Veränderungen für uns mit sich, Verzicht auf angenehme Privilegien etc. Im Nachhinein betrachtet war diese Veränderung aber nicht nur negativ. Wir gewannen unter den Unteroffizieren viele Freunde und manche dieser Freundschaften haben noch heute Bestand. Besonders diejenigen, die später wieder in die neuen deutschen Streitkräfte eintraten, haben von dem langen Zusammenleben mit Unteroffizieren und Mannschaften profitiert. Wir konnten uns viel besser in ihr denken und handeln hineinversetzen als andere, die diese Erfahrung nicht gemacht hatten und waren diesen in punkto „innere Führung“ ein gutes Stück voraus. Die Zugfahrt endete, wie schon von einigen vermutet, in Greenock bei Glasgow, wo das 43000 BRT große Passagierschiff „IIe de France“ am „Tail of the Bank“, dem bekannten Ankerplatz Greenocks, schon auf uns wartete. Der Musikdampfer bot ein imposantes Bild. Die Ile de France war 1926 vom Stapel gelaufen und hatte bei den Probefahrten eine Geschwindigkeit von guten 24 Knoten erreicht. Sie fuhr nun unter britischer Flagge und wurde als Truppentransporter verwendet.
Ehe wir an Bord gebracht wurden, sprach es sich wie ein Lauffeuer herum, daß Leutnant Fröschel vorgezogen hatte, aus dem Zug auszusteigen und auf die Seereise zu verzichten. Er hatte es fertiggebracht, durch ein aufgebrochenes Abteilfenster während der Fahrt aus dem Zug zu springen und unterzutauchen. Aber auch diesmal hatte er sich verrechnet. Die lle de France lichtete nicht gleich den Anker, sondern verblieb noch drei Tage auf Reede, nicht um auf Fröschel zu warten, sondern um ein paar hundert kanadische Urlauber aufzunehmen, die zusammen mit ca. 1000 POWs die Fahrt nach Hause antreten sollten. Fröschel, ohne Proviant ausgerissen, vertraute darauf, dass die Gefangenen unverzüglich den Weg über den Atlantik antreten würden, und meldete sich sehr hungrig nach zwei Tagen bei einer schottischen Polizeidienststelle. Von dort bis zur lle de France war es nur ein kleiner Schritt, und so musste auch Fröschel in den sauren Apfel – Abschied von der Insel – beißen. Er wurde von seinen Offizierkameraden, wie wir später erfuhren, mit großem Hallo empfangen. Was für ein Mann! Ich frage mich, was wohl aus ihm geworden ist.
Beim Anbordgehen auf die lle de France wurde mir schmerzlich bewußt, dass diese Seereise nichts von dem Komfort der Überfahrt von Afrika nach England haben würde. Zunächst einmal ging es Niedergänge auf Niedergänge hinab in den Bauch des Schiffes bis in das unterste Wohndeck, das wahrscheinlich zum Teil noch unter der Wasserlinie lag. Festzustellen war das zwar nicht genau, es gab Bullaugen, aber die waren mit aufgeschraubten Blenden versehen, so daß wir keinen Blick hinaus werfen konnten. In dem riesigen Deck waren eng an eng vierstöckige Pritschen angebracht, die für die nächsten zehn Tage unsere Heimat werden sollten. Wir peilten sofort die Lage und sicherten uns Kojen in unmittelbarer Nähe des einzigen Niedergangs, der uns im Falle eines Falles eine geringe Chance bot, der Mausefalle zu entkommen und nicht wie junge Katzen im Sack zu ersaufen. Der Niedergang war eng und an seinem Fuß durch eine mit Stacheldraht verkleidete Tür gesichert, die nur geöffnet wurde, wenn wir ein paar Decks höher in den Speisesaal oder zum Luftschnappen an Oberdeck geführt wurden. Jeder von uns hatte zwar auf seiner Koje eine Schwimmweste vorgefunden, die aber mehr symbolischen Wert hatte. Sollte es dazu kommen, dass die lle de France einen oder mehrere Torpedos verpaßt bekam, dann ade du mein lieb Heimatland. Wir „seemännischen Experten“ waren aber mehr oder weniger der Meinung, die Wahrscheinlichkeit einem U-Boot zum Opfer zu fallen, sei sehr gering. 1944 war ja schon das zweite Jahr des großen U-Boot- Sterbens. U-Bootverluste und versenkte feindliche Schiffe hielten sich der Zahl nach fast die Waage und zudem waren wir gewiß, dass die lle de France mit ihren 24 Knoten als Einzelfahrer laufen würde. Ihre hohe Geschwindigkeit, mit der kein U-Boot mithalten konnte, war ihr bester Schutz. Sicher, es waren im Laufe des Krieges auch schon schnelle Fahrgastschiffe, die nicht im Geleit fuhren, versenkt worden, aber die waren an einer Hand abzuzählen, und keines hatte die Größe der lle de France gehabt. So beruhigten wir unsere Kameraden von der Luftwaffe und dem Heer, die ihre Befürchtungen nicht zurückhielten.
Endlich war der Zeitpunkt des Auslaufens gekommen. Die Schiffsmaschinen nahmen ihre Tätigkeit auf, und an den Bewegungen des Rumpfes konnten wir feststellen, daß der Kahn Fahrt machte. Es begann nun eine elend langweilige Zeit, die wir uns so gut wie möglich mit Kartenspielen, Reden und Lesen vertrieben. Dreimal täglich wurden wir zum Essen in den Speisesaal geführt. Damit wir keinen Unsinn anstellen konnten, waren MGs an den Stirnseiten des Speisesaals aufgebaut. Das Essen war weder schlecht noch reichlich, so daß wir jungen Hüpfer ständig Kohldampf hatten. Das sollte sich aber bald zugunsten der Seeleute ändern. Denn unseren Kameraden von Heer und Luftwaffe verging großenteils der Appetit, als wir aus dem Nordkanal hinaus in den Nordatlantik hineinstießen und die See unruhig wurde. Nur wer selbst einmal seekrank war, weiß, wie abstoßend Nahrungsmittel, besonders im gekochten Zustand, auf Seekranke wirken; und so war es nicht verwunderlich, daß wir vom Zustand der Betroffenen profitierten und uns ab und zu den Magen vollschlagen konnten. Neben den Mahlzeiten durften wir einmal pro Tag an Oberdeck, um uns auszulüften. Das tat gut, obwohl bittere Kälte herrschte und unsere Zeit an Oberdeck sehr begrenzt war. Nachdem wir die äußeren Hebriden mit ihren bizarren Felsformationen hinter uns gelassen hatten, nahm uns die unendliche Weite des Nordatlantiks auf; für viele von uns ein nicht unbekanntes Gewässer. Schon am ersten Tag unserer Seefahrt hatten wir beim Auslüften feststellen können, daß die lle de France tatsächlich mutterseelenallein als Einzelfahrer durch den Atlantik furchte, ohne auch nur die geringsten Anstalten zu einem Zickzackkurs zu machen. Zunächst wurden wir noch ab und zu von Flugzeugen des Coastal Command überflogen, aber auch diesen Schutzschirm ließen wir schließlich hinter uns.
Da unsere Offiziere, die in einem der oberen Decks zu zweit und viert in bequemen Kammern untergebracht waren, auch hier an Bord Anspruch auf ihre Aufklarer hatten, ging täglich ein Kommando von diesen nach oben um aufzuklaren. Es gelang mir eines Tages, als Führer eines solchen Kommandos unsere Offiziere zu besuchen und mich mit ihnen zu unterhalten. Sie waren baß erstaunt, mich aufkreuzen zu sehen und gaben zu erkennen, wie sehr sie bedauerten, daß sie nicht mehr mit uns zusammen sein konnten. Auch Fröschel traf ich wieder und der hatte natürlich schon wieder große Rosinen im Kopf. Ihm schwebte vor, den Kahn zu kapern und ins neutrale oder besetzte Ausland zu entführen. Er fragte mich, ob die Unteroffiziere und Mannschaften an einem solchen Unternehmen teilnehmen würden. Ich gab ihm zu verstehen, daß das keine Frage sei, natürlich würden wir genug Verrückte finden, die sich diesem Unternehmen „Wahnsinn“ anschließen würden. Solange wir jedoch eingesperrt als Bilgenkrebse unser Dasein fristeten, sei wenig Unterstützung von uns zu erwarten. Es ginge nur, wenn die ganze Sache entweder während einer Mahlzeit oder beim Auslüften stattfände. Ich machte ihn aber darauf aufmerksam, daß wir bei diesen beiden Tätigkeiten immer in die Läufe von schußbereiten MGs blickten und die Chancen verdammt dürftig seien. Er verfolgte diesen Plan ernsthaft weiter, bis der deutsche dienstälteste Offizier sein Veto einlegte. Das ganze hätte in einem Blutvergießen oder Massaker geendet, und Oberst v.H. war viel zu sehr Realist, um die unausgereiften Pläne einiger junger Hitzköpfe zu genehmigen. So blieb alles beim alten. Wir schmorten weiter in unserem Mief im Bauch des Kahns und die von „upstairs“ genossen ihre Reise. Nach einigen Tagen näherten wir uns der kanadischen Küste. Und oh Wunder, wir wurden darüber informiert.
Dann war es soweit. Beim Abendessen konnten wir durch die nicht mehr mit Blenden versehenen Fenster die hell erleuchtete Küste des dritten Kontinents, auf den ich als POW meine Füße setzen sollte, deutlich ausmachen. Für uns alle, die wir schon jahrelang mit der Verdunklung gelebt hatten, war es ein kleines Wunder, und einer von uns bemerkte ganz treffend: „Die müssen sich ja schon ganz schön sicher fühlen, wenn sie die Festbeleuchtung brennen lassen.“ Und so war es auch. Die Alliierten waren der Bedrohung durch die deutsche U-Bootwaffe Herr geworden, und wer sonst stellte während des Krieges eine Gefahr für den amerikanischen Kontinent dar? Der Gedanke, daß der Krieg bereits im Frühjahr 44 zu Gunsten der Allliierten entschieden war, kam jedoch keinem von uns; noch immer äußerte niemand Zweifel an unserem Endsieg. Indoktrinierung schaltet wahrscheinlich den Verstand der Betroffenen aus; eine objektive Beurteilung der Lage fand einfach nicht statt, aber wie sollte man von uns jungen Hüpfern erwarten, was unsere glorreiche und unfehlbare oberste militärische Führung offenbar nicht begriffen hatte oder nicht begreifen wollte. Erst im Nachhinein, als der Krieg schon Schnee von Vorgestern war, wurde mir und vielen meiner Generation bewußt, wie erbärmlich sich der Großteil der deutschen Generalität und Admiralität vor den Karren des Mannes hatte spannen lassen, den sie zwar als „böhmischen Gefreiten“ verspotteten, jedoch ohne es aber für entwürdigend zu halten, aus seiner Hand Marschallstäbe und Latifundien entgegenzunehmen. Aber es hat wohl auch niemand von ihnen gewußt, was im Hinterland der von ihren Truppen eroberten Länder vor sich ging. Man verschloß Augen und Ohren, und die, die dazu beitrugen, daß der Name Deutschland bis in alle Ewigkeit mit brutalem Völkermord in Verbindung gebracht wird, gehörten auch nicht der Wehrmacht an, sondern der Partei und trugen das Hoheitsabzeichen nicht auf der Brust sondern auf dem Oberarm. So einfach war das, und wären nicht die Männer des 20. Juli gewesen, die, wenn auch sehr spät, einen Aufstand des Gewissens versuchten, sähe es düster um eine Tradition für die Bundeswehr aus. Aber dazu sollten Historiker und Politiker ein offenes Wort sagen. Wir nahmen unsere Henkersmahlzeit an Bord der IIe de France ein, und wieder in die Unterwelt hinabgestiegen wurden wir angewiesen, unsere Sachen zu packen – völlig unnötig, denn außer dem Waschzeug hatten wir alles in unseren Seesäcken gelassen – und uns für die Ausschiffung bereitzuhalten. Endlich, mitten in der Nacht ging es los. In Gruppen von je 50 Mann wurden wir abgerufen, verließen über die Gangway die IIe de France und betraten in Halifax, Nova Scotia, das amerikanische Festland.
Halifax war während des Krieges ein wichtiger Nachschubhafen für den europäischen und afrikanischen Kriegsschauplatz gewesen und wimmelte auch bei unserer Ankunft vor Handels- und Kriegsschiffen. Von dort gingen Geleitzüge mit schnellen Schiffen unter dem Tarnnamen HX nach England und von dort zurück nach Halifax mit der Bezeichnung ON.
Viel Zeit, das Hafenpanorama zu begutachten, blieb uns jedoch nicht, denn unter den anfeuernden Rufen der kanadischen Eskorte ging es im Schweinsgalopp zu einem nicht weit vom Liegeplatz der IIe de France bereitgestellten Zug, der uns zu einem der vielen Kriegsgefangenenlager irgendwo in Kanada bringen sollte. Man hatte gleich zwei angenehme Überraschungen für uns bereit: Die erste waren bequeme Abteile, keine Holz- sondern Polsterklasse; die zweite ein bereitstehendes Nachtmahl, das aus einem Eintopf mit ungewöhnlich viel Fleisch bestand. Da wurde uns bewußt, daß wir uns in einem Land befanden, in dem das Wort Lebensmittelmangel ein Fremdwort war. Wir schlugen uns nach langer Zeit richtig den Bauch voll und wurden von den freundlichen kanadischen Posten, die sich in unseren Abteilen befanden, aufgefordert, einen Nachschlag zu empfangen. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen.
Unsere Wachen waren ältere Herren von den Veteran Guards of Canada, die den ersten Weltkrieg mitgemacht hatten und wußten, wie man mit Gefangenen umgeht. Bei aller Freundlichkeit machten sie uns klar, daß wir nicht auf dumme Gedanken kommen sollten zu versuchen, uns aus dem Staube zu machen. Draußen gäbe es außer der Aussicht jämmerlich zu erfrieren nichts von Bedeutung für uns, und notfalls würden sie uns einen auf den Pelz brennen. Ich glaube, mich erinnern zu können, daß das Thema Flucht in diesem Moment nicht Priorität eins hatte. Wir fühlten uns wohl in der angenehmen Wärme des Zuges, mit vollem Magen, und wußten als erfahrene POWs, daß eine Flucht in einem wildfremden Land nicht eine ad hoc Angelegenheit war sondern einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung bedurfte.
Endlich setzte sich der Zug in Bewegung, und die Fahrt durch das nächtliche Neu Schottland begann. Zunächst schauten wir interessiert aus den unverhängten Fenstern, aber außer einem gelegentlichen Stationsschild, verschlafenen Gehöften und kleineren Ortschaften konnten wir nicht viel ausmachen. Ich erinnere mich noch, daß wir in Truro kurz anhielten, dann schlief ich ein.
Die Fahrt bis zu unserem endgültigen Bestimmungsort nahm einige Tage in Anspruch und war von vielen neuen Eindrücken geprägt. Kanada war damals (und ist es noch heute) ein faszinierendes Land. Die Orte Riviere du Loup und Trois Rivieres in Quebec, die wir passierten, waren in den 40ern noch Pionierstädte und wir genossen sie besonders, weil wir uns beim Aufenthalt auf ihren Bahnhöfen gruppenweise außerhalb des Zuges die Füße vertreten durften.
Das Land schien endlos zu sein und aus Wäldern, Seen und Flüssen zu bestehen. Unwillkürlich drängten sich mir Erinnerungen an die Lederstrumpf Bücher von James Fenimore Cooper auf, die ich als Junge verschlungen hatte. Sie hatten ihre Schauplätze hier in der kanadischen Provinz Quebec, die wir gerade durchfuhren und um deren Besitz sich in Coopers Büchern Briten und Franzosen mit verbündeten Indianerstämmen auf beiden Seiten einen erbarmungslosen Kampf geliefert hatten. Ich sah Unkas, den letzten Mohikaner, und seinen Vater Chingachgook, die große Schlange, Wildtöter und die Mingos auf dem Kriegspfad, den Kampf um das schwimmende Fort auf dem See und den Tod des Mohikaners, der mich als Kind so erschüttert hatte. Eigentlich war es auch gar nicht so lange her, daß mich Bücher dieser Art begeisterten, sechs, sieben Jahre vielleicht. Cooper und Karl May sowie Steuben waren die Lieblingsautoren meiner Jugend gewesen. Wir hatten uns beim Indianerspielen Namen aus ihren Büchern zugelegt und versucht, Szenen daraus nachzuspielen.
Aber auch die längste Eisenbahnfahrt geht einmal zu Ende. Nachdem wir schließlich Quebec hinter uns gelassen hatten, konnten wir auf den Stationsschildern wieder englische Ortsnamen lesen. Wir befanden uns nun in der Provinz Ontario. An Ottawa, die in Ontario gelegene Hauptstadt Kanadas, kann ich mich nicht erinnern. Wir hatten sie wohl nachts durchfahren. Wir passierten Pembroke und landeten endlich am Ziel unserer Reise, dem Militärlager Petawawa. Das abseits der gleichnamigen Stadt gelegene Camp sah wie alle Truppenübungsplätze der Welt aus: Staubige Straßen und endlose Reihen von Holzbaracken. Unser Aufenthalt hier war aber nur von kurzer Dauer. Neben dem Bahnsteig war eine große Zahl von LKWs bereitgestellt, die uns zum endgültigen Schlußpunkt unserer Reise bringen sollten, dem Camp 33 Petawawa. Wir bestiegen also die Fahrzeuge und weiter ging es auf immer primitiveren Straßen hinein in den kanadischen Busch. Nach etwa einstündiger Fahrt tauchte vor uns ein größerer See auf, der Centre Lake, an dessen Ufer auf einer Lichtung das Lager lag. Ein doppelter Stacheldrahtzaun umgab eine Anzahl von Holzbaracken: unser künftiges Domizil. Das Ganze hatte eine Ausdehnung von ca. 200 x 600 m und erschien uns recht passabel. Ehe wir jedoch das Lager betreten durften, wurden wir in einer Schleuse vor dem Lager noch einmal gründlich gefilzt (durchsucht), damit wir keine Mordwerkzeuge mit hineinschleppten. Dabei stellte sich leider heraus, daß einige Lords und Landser zerschnittene Kapok-Schwimmwesten von der IIe de France hatten mitgehen lassen, die sie als Kissen benutzen wollten. Sicher war ihnen nicht bewußt gewesen, daß sie damit einem kanadischen Soldaten oder deutschen Kriegsgefangenen, die weiter auf diesem Schiff den Atlantik überqueren würden, das einzige individuelle Rettungsmittel entwendet hatten. Die Kanadier und auch wir hatten kein Verständnis für diese Leute und auch kein Mitleid mit ihnen, als sie gleich in die Arrestzellen wanderten.
Ca. 50 bis 60 Mann bezogen dann eine Baracke, sauber getrennt nach Dienstgraden, Feldwebeldienstgrade für sich, desgleichen Uffz., Maate und Obermaate und die Mannschaftsdienstgrade, die den größten Teil der Lagerbewohner ausmachten. Die Baracken waren auf Pfeilern aufgesetzt und sahen wie Pfahlbauten aus. Das hatte seinen guten Grund. So wurde verhindert, daß man unter den Baracken mit dem Bau von Tunneln beginnen konnte, ohne daß dies den Posten auffiel. Diese Fluchtmöglichkeit fiel also von vornerein aus. Die Baracke selbst bestand aus einem einzigen großen Raum, an dessen beiden Längsseiten je eine Reihe doppelstöckiger Kojen stand. Ich hatte das Glück, eine obere Koje am Ende einer Reihe zu ergattern, so daß ich nur mit dem Geschnarche von einer Seite fertigwerden mußte. Mein Untermieter war Georg Nistroy, Maschinenmaat aus Oberschlesien, ein prima Kerl, der oft von den anderen wegen seines oberschlesischen Dialektes auf die Schippe genommen wurde und den Spitznamen „Perunje aus Gleiwitz“ erhielt. „Hab ich gegessen drei Teller Reis aus!“ hatte er einmal gesagt, und dieser Ausspruch verfolgte ihn, wo immer er aufkreuzte.
Durch einen Gang am Ende der Baracke gelangte man zu Toiletten, Duschen und Waschraum, die auch von den Bewohnern einer zweiten Baracke, die auf die gleiche Weise mit diesen Räumlichkeiten verbunden war, benutzt wurden. In der Mitte der Baracke zwischen den Kojenreihen waren Tische und Stühle aufgestellt und drei riesige eiserne Öfen für den Winter.
Nachdem wir uns so häuslich wie möglich eingerichtet hatten – Spinde zum Verstauen der Sachen gab es nicht – machten wir uns erst einmal daran, das Lager einer Erkundung zu unterziehen. Was wir sahen, stellte uns zufrieden. Es gab einen Fußballplatz mit richtigen Toren, einen Turnplatz mit Reck, eine Sprunggrube und einen Ring für Kugelstoßen. Für die körperliche Ertüchtigung war also vorgesorgt. Unser Hauptaugenmerk galt natürlich der Küche, denn die Gedanken eines POW kreisten beständig um sein leibliches Wohl. Wir fanden eine gut eingerichtete Küche und einen großen Speisesaal, in dem wir schichtweise alle Mahlzeiten einzunehmen hatten. Ferner gab es eine Kantine, wo wir Toilettenartikel, Tabak, Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten kaufen konnten. Im gleichen Gebäude waren auch eine Bibliothek und die deutsche Lagerführung untergebracht. Der doppelte Zaun des Lagers war mit einer Anzahl von Wachtürmen versehen, auf denen gelangweilte Posten vor sich hindösten. Parallel zum Zaun und von diesem durch einen Warndraht abgeschirmt verlief ein Spazierweg rund um das Lager, der ständig von rennenden oder gehenden POWs frequentiert wurde. Das Seltsame aber war, daß alle ihn nur in einer Richtung benutzen, das schien ein ungeschriebenes Gesetz, damit keiner mit einem anderen kollidierte.
Aus der Vogelperspektive betrachtet hatte unser Lager die Form eines Eies, an dessen schmaler Spitze ein Wachturm stand. Dieser Turm besaß eine Galerie, auf der die Posten den Turm umrunden konnten und so einen ausgezeichneten Blick sowohl auf das Lager als auch dessen Umgebung hatten. Zu allem Überfluß war die Galerie noch mit einer Art Brückennock an jeder Längsseite ausgestattet, von denen die Wachen direkt in den Raum zwischen den beiden Zäunen bis zum nächsten Wachturm sehen konnten. Die breite Spitze des Ovals besaß den einzigen Ausgang aus dem Lager, ein doppeltes Lagertor mit einer Filzschleuse zwischen den einzelnen Toren. Im ganzen Lager gab es keinen Baum und keinen Strauch. Alles war darauf angelegt, das Tun und Lassen der Lagerinsassen stets unter Kontrolle zu haben. Die Anlage von Beeten mit niedrig wachsenden Blumen hatte man uns jedoch gestattet. Soweit das Innere des Lagers, das etwa 600 Gefangene beherbergte. Zum Großteil U-Bootfahrer und Flieger; das Heer, vertreten durch das Afrikakorps, fand sich hier in der Rolle einer Minderheit wieder.
Jenseits des Doppelzaunes, der uns die Freiheit vorenthielt, befanden sich an der einen Längsseite, durch eine geschotterte Straße vom Zaun getrennt, die Unterkunfts- und Verwaltungsbaracken des Wachpersonals, das ungefähr Kompaniestärke hatte. Diese Baracken unterschieden sich von denen innerhalb des Lagers nur dadurch, daß sie nicht auf Pfählen standen. Es gab dann noch einige Hallen für die Kraftfahrzeuge des Wachpersonals, und damit erschöpfte sich schon das Ganze. Die andere Längsseite grenzte, nur durch einen Fahrweg von ca. 3 bis 4 m Breite von diesem getrennt, an den Centre Lake, dessen Ufer mit Ausnahme des für das Lager gerodeten Teils dicht bewaldet waren. Bei der Anlage des Lagers hatte man den Busch gerodet, bis eine genügend große Lichtung entstand, die die Innen- und Außeneinrichtung des Lagers aufnehmen konnte. Es war gewissermaßen eine Insel im kanadischen Urwald. Die einzige Verbindung mit der Außenwelt bestand in einer Straße, die zum Military Camp und Truppenübungsplatz Petawawa führte. Damit sich kein ungebetener Gast dem Lager nähern konnte, hatte man etwa 200 m von der schmalen Spitze des Lagerovals entfernt an der Straße einen Schlagbaum und eine kleine Hütte für die dazugehörigen Posten entwickelt. Wir waren nicht die ersten Bewohner des Camp 33. Vor uns hatte es als Internierungslager für deutsche Handelsschiffsbesatzungen gedient, deren Schiffe entweder in alliierten Häfen beschlagnahmt worden waren oder die man auf See aufgebracht hatte. Diese Mannschaften hatten zwar Spuren hinterlassen, wir fanden den einen oder anderen Kassiber, waren aber vor unserer Ankunft verlegt worden, nachdem sie das Lager für uns in einen blitzsauberen Zustand gebracht hatten; man konnte vom weißgescheuerten Fußboden essen. So kam der erste Abend unseres Aufenthaltes in der neuen Umgebung, das Abendessen war gut und reichlich gewesen, wir spielten in unseren Baracken noch eine Runde des obligatorischen Skat oder Doppelkopf, machten einen Verdauungsspaziergang und krochen um 22:00 Uhr brav in unsere Kojen. Diese waren mit richtigen Matratzen versehen; so schliefen wir gut und fest einem neuen Tag unserer Gefangenschaft, einem von vielen hundert, die noch auf uns warteten, entgegen. Die Kanadier störten unsere Nachtruhe nicht. Von ihnen hielt sich nachts keiner innerhalb des Lagers auf. Die einzigen Geräusche kamen vom Feuerposten, der die drei Öfen der Baracke zu betreuen hatte. Man darf nicht vergessen, wir befanden uns in den ersten Märztagen noch im strengsten Winter und die Feuerwachen, die wie an Bord vier Stunden Wache gingen, hatten ein verantwortungsvolles Amt. Ohne die glühenden Kanonenöfen wäre es für uns alle unangenehm kalt geworden, um es milde auszudrücken. Neben jedem Ofen waren genügend Holzscheite aufgestapelt, logs, wie die Kanadier sie nannten, um die Öfen über Nacht damit zu füttern.
Dann kam der nächste Morgen, und von einer Art U. v. D. geweckt begann die Routine eines Gefangenenalltags. Zunächst drängte sich alles im Waschraum und in den Toiletten. Es gab warmes und kaltes Wasser in den primitiven aber zweckmäßigen Waschräumen, und im Großen und Ganzen nahm es jeder Ernst mit der Körperpflege. Natürlich kam es hin und wieder vor, daß der eine oder andere keine besondere Freundschaft zum Wasser entwickelte; da paßten aber die Kameraden auf und steckten die wasserscheuen Drückeberger unter die kalte Dusche. So hart es klingen mag, solche drastischen Methoden waren nötig im Interesse der Allgemeinheit. Das Zusammenleben vieler auf engem Raum ist eine Brutstätte von Ungeziefer, wenn man es mit der Sauberkeit nicht genau nimmt. Dann ging es in zwei Schichten zum Frühstück, das gut und reichlich war. Es bestand aus Bohnenkaffee oder Tee, Weißbrot, Butter und Marmelade und sonntags auch Kuchen oder Pfannkuchen mit Ahornsirup. Es mußte keiner hungern, im Gegenteil, die Zuteilung an die Küche war so reichlich, daß Lebensmittel verbrannt wurden, um sie nicht zurückgeben zu müssen. Wir betrachteten das nicht als Sünde, sondern wollten damit, einfältig wie wir nun einmal waren, die Ernährungsfront des Gegners schwächen. Aber es kamen auch schlechtere Zeiten, in dem wir uns nach dem verlorenen Paradies zurücksehnten.
Doch bis dahin war noch ein weiter Weg, jetzt jedenfalls lebten wir wie die Maden im Speck und hatten kein schlechtes Gewissen dabei. Nach dem Frühstück machten die Fitnessfanatiker ihren Morgenlauf und die Bequemen ihren Morgenspaziergang, bis es Zeit für den Morgenrollcall war. Dazu traten wir barackenweise auf dem Sportplatz an und die Barackenältesten meldeten dem deutschen Lagerführer die Zahl der Angetretenen. Dieser tat das gleiche dem kanadischen Sergeanten gegenüber und last not least erstattete der Sergeant dem kanadischen Offizier vom Dienst Meldung. Dann ging die zeitraubende Prozedur des Vergleichs der gemeldeten Zahlen mit den wirklich angetretenen POWs über die Bühne. Kopf für Kopf wurden die einzelnen Baracken durchgezählt, und wir waren immer sehr glücklich, wenn schon beim ersten Versuch Deckungsgleichheit bestand. Dann hatten wir nach dem Reinschiff in den Baracken Freizeit bis zum Mittagessen; jeder ging der Beschäftigung nach, die ihm zusagte. In den ersten Tagen im neuen Camp war diese Beschäftigung rein individualistisch. Lesen, spielen, basteln und sich körperlich fithalten, das waren die Gebiete, die ein weites Feld für eine Betätigung boten. Den meisten war auch klar, daß man etwas tun mußte, um nicht geistig zu verkümmern oder gar zu verblöden. Und es dauerte nicht lange, bis sich auf freiwilliger Basis Unterrichtsgruppen bildeten, die die Fähigkeiten von Spezialisten vieler Fachgebiete nutzten um Neues zu lernen oder Bekanntes zu vertiefen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele gute Köpfe sich in dem verhältnismäßig kleinen Lager fanden, die etwas zur Allgemeinbildung und Spezialausbildung ihrer Kameraden beitragen konnten.
Nach dem Mittagessen gönnte man sich erst einmal Ruhe und gab sich dem Matrazenhorchdienst hin; dann ging es in der geschilderten Weise weiter. Da wir von den Kanadiern auch Tageszeitungen erhielten, die kaum von der Tusche eines Zensors verunstaltet waren, gab es in jeder Baracke täglich eine Zeitungsschau, um auch den Kameraden, deren Englisch noch nicht gut genug war, auf dem Laufenden zu halten. In unserer Baracke war mir die Aufgabe zugefallen, die Zeitungen auszuwerten und den Kameraden vorzutragen, was in der Welt vor sich ging. In erster Linie war man natürlich am Verlauf des Krieges interessiert. Da wir auf unserer Insel praktisch von der Außenwelt abgeschnitten lebten – Neuzugänge, die uns die Lage aus deutscher Sicht schildern konnten, gab es nicht – bildeten die kanadischen Zeitungen die einzige Informationsquelle. Zunächst waren viele von uns skeptisch, was den Wahrheitsgehalt der Meldungen anging. „Propaganda“ und „Die spinnen ja lauwarm“ waren häufige Kommentare der Zuhörer meiner Presseschau. Besonders die Berichte von Erfolgen der Roten Armee und der Alliierten im Mittelmeerraum wurden angezweifelt. Die Angaben über die Zahl versenkter deutscher U-Boote hingegen fanden wenig Widerspruch; hier hatten viele am eigenen Leib erfahren, daß die Zeit der Sondermeldungen vorbei war und die Alliierten uns technisch und taktisch so überlegen waren, daß die Fortsetzung des U-Bootkrieges mit untauglichen Mitteln nur zur schnelleren Vernichtung der einst so erfolgreichen Waffe führen konnte. Hatte das unser „großer Löwe“ (Dönitz) nicht erkannt? Glaubte er wirklich, was er den U-Boot-Besatzungen einhämmerte, wenn er sie wider aller Vernunft hinaus in den fast sicheren Tod schickte; daß ihr Einsatz tausende von alliierten Flugzeugen von Angriffen gegen die deutsche Zivilbevölkerung abhielt? Er hätte es besser wissen müssen. Wir aber vertrauten ihm weiter, und ich kann mich nicht erinnern, daß vor Kriegsende je ein Wort gegen Dönitz erhoben wurde.
Neben den Nachrichten von Kriegsschauplätzen interessierten natürlich auch andere Dinge, und es war eine zeitraubende Arbeit, täglich eine vernünftige Presseschau auf die Beine zu stellen. So legte ich mir dann auch bald zwei Gehilfen zu, Wilhelm Krüger, den einzigen Fähnrich außer mir in diesem Lager und einen Unteroffizier, der im Zivilberuf als Lehrer Englisch unterrichtet hatte. Wilhelm Krüger, allgemein als Ohm Krüger bekannt, erfuhr hier im Lager auch eine verspätete Ehrung. Er war auf einem der Flottentorpedoboote gefahren und Ende 43 im Gefecht mit britischen Überwasserstreitkräften in der Biskaya abgesoffen und aus dem Wasser gefischt worden. Nun erhielt er vor angetretenem Lager das Eiserne Kreuz 2. Klasse. So etwas war möglich, auch noch 1944. Die Schweizer Gesandtschaft in London übermittelte solche Angelegenheiten aufgrund von Berichten der deutschen Gesandtschaft in Bern an die Betroffenen. Die deutsche Bürokratie wenigstens funktionierte perfekt bis zum bitteren Ende; es müssen Divisionen von Bürokraten so dem Fronteinsatz entzogen worden sein. Aber, so sahen wir das damals nicht, im Gegenteil; es schien uns der Beweis dafür zu sein, daß es so schlecht mit uns gar nicht stehen konnte.
Eines Morgens wurden wir mit der Nachricht überrascht, daß Arbeitskommandos gebildet werden sollten, die im kanadischen Busch Nachschub für unsere Öfen und die Kamine in Ottawa und anderen kanadischen Städten besorgen sollten. Kurz, wir sollten das tun, womit sich die Besatzungen der Boote oft voneinander verabschiedet hatten: „Auf Wiedersehen beim Holzfällen in Kanada!“ Der Andrang zu diesen Kommandos war groß. Das war auch nicht verwunderlich, denn jedes eingesperrte Tier, und wird es auch noch so verwöhnt, sehnt sich danach, aus seinem Käfig herauszukommen, und sei es auch nur für kurze Zeit. Auch meine Freunde, Ohm Krüger, Wilhelm Dehler, Wilhelm Grap, Georg Niestroy, der Perunje aus Gleiwitz, Hartwig Becker, Max Vollmer, Willi Klausmeier, Willi Weber (alle von der Marine) und ich wurden von der deutschen Lagerleitung für würdig befunden, einem dieser Kommandos anzugehören. So fuhren wir denn morgens früh mit Lkws bei klirrender Kälte in die Wälder, um dort unsere überschüssigen Kräfte loszuwerden. Unser Ziel war der Algoquin Provincial Park, wo wir unter der Leitung eines kanadischen Forstbeamten, der dem Department of Mines and Ressources unterstand, darangingen, Bäume zu fällen und sie kamingerecht zu zerlegen. Unser Werkzeug bestand aus zweischneidigen Äxten und Zugsägen von zwei Meter Länge, und es war harte Knochenarbeit, bis wir mit dem Ruf „timber“ anzeigen konnten, daß ein Baum im Begriff war, in die von uns gewünschte Richtung zu fallen. Da wir aber alle keine ausgebildeten Lumberjacks (Holzfäller) waren, gab es bei der nicht ungefährlichen Arbeit häufig Verletzungen. Ehe es mich erwischte, verletzte ich meinen Freund Wilhelm Grap an der Hand, als meine Axt beim Abschlagen eines Astes abglitt, und er seine Hand, die den Ast in der richtigen Stellung hielt, nicht rechtzeitig zurückziehen konnte. Er blutete wie ein Ferkel und wurde sofort zur Behandlung in das Lazarett des Truppenübungsplatzes gefahren, wo man eine zerrissene Sehne wieder zusammenflickte. Zu unser aller und meiner ganz besonderen Freude genas er schnell und konnte seine Hand wie vorher benutzen. Er hat es mir nicht nachgetragen. Dann ging es mir an den Kragen. Ich hatte den Ruf „timber“ wohl überhört und wurde von der Spitze eines fallenden Baumes am Kopf erwischt. Auch ich wurde zur ersten Behandlung ins Lazarett gebracht, die Platzwunde dort fachgerecht versorgt und mit einem dicken Turban versehen kam ich ins Lager zurück und berichtete den Kameraden, daß es außer den Männern im Lager noch ein anderes Geschlecht zu geben schien, denn es war mir ein weibliches Wesen begegnet. Wir alle hatten seit unserer Ankunft in Camp 33 keine Frau mehr zu Gesicht bekommen, und das Leben im Zölibat, das für manche von uns schon Jahre dauerte, war ein echtes Problem. Wir alle waren gesunde junge Burschen, und es war nur natürlich, daß unsere Gedanken sich mit dem Thema Frau beschäftigten. Homosexualität gab es jedoch kaum im Lager; wenn ein Pärchen erwischt wurde, kam es um eine Abreibung nicht herum, denn auch hier hatte die NS-Erziehung bewirkt, daß gleichgeschlechtliche Beziehungen als etwas Unsauberes galten und nicht toleriert werden durften. Es wurde in dieser erzwungenen Männergesellschaft ganz kräftig geschweinigelt und mit erotischen Heldentaten geprahlt, letztendlich aber half die Natur sich selbst und im Traum erlebte man das, was einem die Wirklichkeit vorenthielt. Mancher prahlte damit vor den Kameraden und Aussprüche wie: „Heute Nacht ist mir einer abgegangen, und fast von alleine!“ waren keine Seltenheit. Es sollten für mich aber noch mehr als zwei Jahre vergehen, bis ich wieder eine Frau berührte und wieder von ihr berührt wurde.
Während ich noch meine Wunde im Lager pflegte und auf die Arbeit im Busch verzichten mußte, kam in der Person eines katholischen Divisionsfahrers des Afrikakorps ein interessanter Mann zu uns ins Camp 33. Pfarrer F. war in der Tat ungewöhnlich in seinem Verhalten und Auftreten als katholischer Geistlicher und er hatte im Nu das ganze Lager für sich eingenommen. Er spielte mit uns Fußball und forderte seine katholischen Schäfchen auf, eine Lagerrunde mit ihm zu drehen, wenn sie das Bedürfnis hatten, die Beichte abzulegen. Er tat auch etwas für uns fünf Oberfähnrich und Fähnriche, die sich im Camp 33 befanden und trotz vieler echter Freundschaften mit Unteroffiziersdienstgraden doch in der Stellung einer tolerierten Minderheit blieben, die hier einfach nicht hingehörte. Das kam auch dadurch zum Ausdruck, daß keiner der Oberfähnriche Mitglied der deutschen Lagerführung war. Diese Pöstchen, mit denen auch viele kleine Annehmlichkeiten verbunden waren, die das Lagerleben erträglicher machten und sei es nur durch separate Unterbringung in eigenen Räumen oder in Stuben mit geringer Belegung, hatten die Feldwebeldienstgrade selbstredend den ihren vorbehalten. In einer Beziehung hatten sie mit dieser Maßnahme auch Recht, denn früher oder später würden die Oberfähnriche doch befördert und in Offizierslager verlegt werden. Doch zurück zu dem Wohltäter der Fähnriche und Oberfähnriche, Pfarrer F. Gut erzogen wie wir waren, hatten wir uns ihm vorgestellt, denn schließlich hatte er so etwas wie einen Offiziersrang, wenn er in unseren Gesprächen auch immer nur der Himmelslotse hieß. Auf die Vorstellung folgte von seiner Seite prompt eine Einladung, und wir fanden uns eines Abends in seiner geräumigen Unterkunft ein und wurden für Gefangenenverhältnisse fürstlich bewirtet. Seine kanadischen katholischen Amtskollegen außerhalb des Lagers, die er des öfteren aufsuchen durfte, versorgten ihn gut, und er ließ uns daran teilhaben. Wichtiger noch als die guten Zigarren, die wir bei ihm rauchten, war jedoch die Tatsache, daß er uns Bridge beibrachte. Von Skat oder Doppelkopf hielt er nicht allzu viel. So lernten wir von ihm das Culbertson System, das ja von allen Bridgespielern in der Welt bis Ende der 40er Jahre für den Bietprozeß benutzt und schließlich 1949 durch das Goren Punktesystem abgelöst wurde. Da wir alle über einen annehmbaren Kartenverstand verfügten, waren wir dank unseres hervorragenden Lehrers bald in der Lage, diesem Spiel zu frönen. Wir verbrachten so fast jede Woche einen Abend bei Pfarrer F. beim Bridge und genossen nicht nur das Spiel sondern auch die kleinen Extras, die dabei für uns abfielen. Unglücklicherweise löste die Runde sich bald wieder auf, als Gerd (Wanne) Teschke und Hannes Brix, meine Crewkameraden und der dritte Oberfähnrich, der einer Nachcrew angehörte, zum Leutnant befördert wurden und bald darauf Camp 33 verließen, um die angenehmen Seiten eines Offizierslagers zu erfahren. Schließlich traf auch für mich ein Schreiben der Swiss Legation in Great Britain, Special Division, Duke of York Steps, S.W. 1, London ein. Es trug das Datum 21. Mai 1944 und lautete: „Ich beehre mich, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, daß nach einer Mitteilung der deutschen Gesandtschaft in Bern, datiert vom 17. Februar 1944, Sie mit Wirkung vom 1. Mai 1943 zum Oberfähnrich befördert worden sind. Die britischen Behörden sind hiervon verständigt worden. Mit vorzüglicher Hochachtung. Moretti, Legationsrat.“ Meine Beförderung wurde vor versammelter Mannschaft durch den deutschen Lagerführer bekanntgegeben. Mit der Beförderung war jedoch auch die Trennung von meinen Barackenkameraden vorprogrammiert, denn ein Umzug in die Baracke der Feldwebeldienstgrade war auf Dauer nicht zu umgehen. Ich konnte ihn zwar noch eine Weile hinausschieben und avancierte während dieser Zeit aufgrund meines neuen Dienstgrads zum „Barackenältesten“, bald jedoch wurde mir dienstlich befohlen, den Umzug vorzunehmen. Das bedeutete Eingewöhnung in einer neuen Umgebung unter Kameraden, die mir im Lebensalter voraus waren. Sie ging aber reibungsloser über die Bühne als ich es mir vorgestellt hatte. Die Verbindung zu meinen alten Freunden riß zwar nicht ab, aber in der neuen Umgebung gewann ich neue Freunde hinzu. Ich möchte nur einen nennen: Hannes Schwede, Stabsobermaschinist und U-Bootfahrer, ein ganz prima Kerl, mit dem ich mich auf Anhieb glänzend verstand. Da wir gelegentlich auch gemeinsam zur Arbeit im Busch eingeteilt waren und beide den Duft der Freiheit dem Lagermief vorzogen, ergab sich wie von selbst, daß wir auch gemeinsam der Ansicht waren, ein Ausflug in die endgültige Freiheit wäre nicht zu verachten.
Das Thema Flucht, das im Mannschaftslager nicht eine Priorität wie im Offizierlager besaß, beschäftigte uns beide von nun an sehr intensiv. Es wäre an und für sich ein leichtes gewesen, von der Arbeitsstelle im Busch zu verschwinden. Die bewaffneten Posten, die uns zur und während der Arbeit begleiteten, waren Daddies, die vom Alter her unsere Väter hätten sein können. Sie rechneten kaum damit, daß einer von uns so blöd sein könne, abzuhauen. Wohin sollten wir auch? Die schönen Zeiten waren längst vorüber; die USA seit Dezember 1941 im Krieg mit uns und als neutrales Land kein sicherer Zufluchtsort für entflohene Kriegsgefangene mehr. Wie sorglos unsere Wachen waren, zeigte sich des öfteren während der Mittagspause, die wir gemeinsam in einem großen Zelt verbrachten, in dem auch gegessen wurde. Sie stellten ihre Gewehre unbeaufsichtigt in eine Ecke, und es kam sogar so weit, daß sie uns aufforderten, ihnen deutsche Gewehrgriffe vorzumachen. Dabei waren die Gewehre aber vorher entladen worden, denn ganz trauten sie uns wohl doch nicht. Diese Flucht von der Arbeitsstelle war jedoch aus anderem Grunde ausgeschlossen; es bestand ein Befehl der deutschen Lagerleitung, der allen Gefangenen klipp und klar verbot, diesen leichten Weg zu gehen. Die Begründung dafür war für alle einleuchtend. Wenn einer von der Arbeitsstelle entfloh, würden die Kanadier sofort die Außenarbeiten einstellen lassen. Das hätte nicht nur einen materiellen Nachteil gehabt, weil damit die 50 Cent täglichen Arbeitslohns entfielen, sondern einen weit bedeutenderen im psychologischen Bereich. Die Arbeit draußen trug wesentlich dazu bei, Spannungen und Aggressionen abzubauen, weil sie eine Abwechslung in das Einerlei und die Langeweile des Lagerlebens brachte und auch im physischen Bereich den Abbau überschüssiger Kräfte bewirkte. Wenn also jemand unbedingt das Weite suchen wollte, mußte er den schweren Weg gehen, nämlich von innerhalb des Lagers durch den doppelten Zaun. Das war natürlich mit der Gefahr verbunden, dabei erwischt zu werden und im schlechtesten Fall eine blaue Bohne verpaßt zu bekommen.
Hannes Schwede und ich machten uns darüber jedoch keine Gedanken. Das alte Eskaperfieber hatte von uns Besitz ergriffen, und eines der Symptome dieser Krankheit bestand darin, daß es den Verstand beeinträchtigte. So schmiedeten wir Pläne, wenn wir abends im Lager unsere Runden drehten oder uns tagsüber im Busch bei der Arbeit verdrückten um die nähere Umgebung in Augenschein zu nehmen. Da war zunächst einmal die Frage zu klären, wohin denn die Reise eigentlich gehen sollte. Kanada war zwar ein Land, in dem man aufgrund der dünnen Besiedelung und seiner endlosen Weite mühelos untertauchen konnte. Das Untertauchen in der kanadischen Wildnis konnte jedoch leicht zum Todesurteil werden, denn das Überleben in der Wildnis hatten wir nicht trainiert und wir besaßen auch nicht die Mittel, um längere Zeit im Busch davon zu leben. Und es fehlte uns vor allem das Wichtigste: Feuerwaffen und die dazugehörige Munition. Die Alternative, die sich anbot, war das Untertauchen in irgendeiner kanadischen Großstadt. Da kam vor allem Ottawa in Frage, weil es die nächstgroße Stadt war. Da man aber eine ausgiebige Fahndung nach uns anstellen würde mit allem was dazu gehört wie Steckbrief mit Lichtbildern etc., war die Chance, unentdeckt zu bleiben, gering. Ja, wenn man Anschriften von Leuten gehabt hätte, die einen Aufgrund ihrer Herkunft aufnehmen und verstecken würden! Aber das war zu schön, um wahr zu sein.
Da trug ein Zufall zur Lösung dieses Problems bei. Einer der wenigen Lords, der den Untergang der „Scharnhorst“ Weihnachten 1943 im Eismeer überlebt hatte, war vor dem Krieg mit seinen Eltern längere Zeit in Kanada ansässig gewesen und hatte auch in den USA in Akron/Ohio Verwandte, von denen er annahm, daß sie uns Unterschlupf gewähren würden. Kurz und gut, er gab uns die Anschriften, wollte aber selbst nicht an dem Abenteuer Flucht teilnehmen. Seine Begründung fand zwar nicht unsere Zustimmung, aber wir tolerierten sie. Er sagte sinngemäß, warum solle er, nachdem er wie durch ein Wunder einer von ca. 20 Seeleuten gewesen war, die von den gut 2000 Mann der Scharnhorst übriggeblieben waren, sein Leben noch einmal und noch dazu kurz vor Toreschluß erneut aufs Spiel setzen? Nun gut, es war auch besser, zu zweit auf die Reise zu gehen, als zu dritt, weil weniger auffällig. Und nun stand fest, das Ziel unserer Flucht sollte zunächst Akron in Ohio sein. Auf einer Karte, die uns zufällig in die Hände gefallen war – Hannes hatte sie aus einem Dienstwagen der Kanadier organisiert – waren wir auch in der Lage, unseren Fluchtweg festzulegen. Es hörte sich ganz einfach an: durch den Zaun und dann immer nach Norden bis wir an die Eisenbahnstrecke von Ottawa nach North Bay stießen. Dann auf einen fahrenden Zug jumpen und als blinde Passagiere nach North Bay fahren. Von North Bay aus immer nach Süden bis Windsor, der kanadischen Grenzstadt am Erie See, oder besser an der schmalen Nordspitze des Erie Sees und dem Lake St. Claire gelegen, und von dort über eine Brücke nach Detroit in Michigan, das Windsor auf der Westseite der schmalen Seespitze gegenüberliegt. Einmal in den vereinigten Staaten wollten wir natürlich nicht bei Ford anheuern, sondern weiter nach Ohio, um endlich in Akron bei den Leuten anzuklopfen, deren Adresse wir hatten. Über den Daumen gepeilt hatten wir eine Strecke von über 1000 km vor uns, aber der Plan faszinierte uns so, daß wir nicht mehr von ihm los kamen. Bis es aber zu seiner Durchführung kam, sollte noch viel Wasser den Petawawa River hinunterfließen und ein weiter Winter ins Land gehen. Der zweite Punkt, der bei einem Unternehmen dieser Art berücksichtigt werden mußte, war die Frage der Lebensmittel für mindestens eine Woche. Nach dieser Zeit, in der wir uns nur bei Nacht bewegen wollten, mußten wir aus dem Lande leben, uns entweder etwas organisieren (stehlen) oder kaufen. Jeder von uns beiden hatte ein paar kanadische Dollar in Besitz, die wir durch kleine Geschäfte mit den Wachen erworben hatten. Die Kanadier waren ganz versessen auf Souvenirs von den deutschen Prisoners und kauften alles von Schnitzereien über Bilder und selbstgebastelte Holzkoffer bis zum alkoholhaltigen Rasierwasser, das sie angeblich tranken. Auch selbstgebrannter Sprit ließ sich gut umsetzen. Das alles war natürlich für beide Seiten illegal und unter strenge Strafen gestellt, aber so what, jeder, der eine Gelegenheit hatte, tat es. Die Lebensmittel für die erste Fluchtwoche zu besorgen, war kein Problem. Die Küche gab für solche Zwecke gut und reichlich auf Anordnung des deutschen Lagerführers das aus, was angefordert wurde. Wir hatten uns entschieden, daß wir in der Hauptsache von Haferflocken gemischt mit Kakao und Zucker und Rosinen leben würden, da diese Art von Verpflegung erstens gut zu transportieren war und zweitens genügend Nährstoffe hatte, um uns auf den Beinen zu halten. Daneben wollten wir ein paar Fleisch- und Fettbüchsen mitnehmen. Angel und Angelhaken waren das erforderliche Gerät, um unsere Verpflegung durch Fische aus den zahllosen Seen und Flüssen zu ergänzen. Eine Axt und ein Messer für jeden und natürlich ein Dosenöffner sollten unsere Ausrüstung vervollständigen. Last not least sollte uns ein selbstgebastelter Kompaß das Finden der richtigen Marschrichtung erleichtern. Kleiden wollten wir uns wie richtige Lumberjacks (Holzfäller) mit großkarierten Hemden, Overalls und von Prisoners gestrickten Pullovern. Die Hemden konnten wir sogar in der Kantine kaufen. Sie wurden aber nur mit der obligatorischen gelben Zielscheibe, mit der der Rücken jedes Oberbekleidungsstücks versehen war, verkauft, so daß wir zwei Hemden benötigten, um die Zielscheibe zu entfernen. Wir hatten uns anfangs strikt geweigert, die uns von den Kanadiern zur Verfügung gestellten Sachen zu tragen, die mit dieser Zielscheibe versehen waren, und liefen lieber in unseren alten Uniformstücken herum. Als es aber mit der Arbeit im Freien außerhalb des Lagers begann, ließen die Kanadier keinen zu diesen Jobs zu, der nicht die vorgeschrieben gekennzeichnete Bekleidung trug. Da mußten wir in den sauren Apfel beißen, wenn wir überhaupt nach draußen kommen wollten. Die Kennzeichnung der Kleidung mit dem gelben Kreis auf dem Rücken hatte einen ganz einfachen Grund. Wenn einer im Busch flitzen ging, bildete die gelbe Sonne auf dem Rücken einen guten Haltepunkt für die Posten.
Wir wußten jetzt also, wohin wir wollten und was wir mitnehmen mußten. Unklarheit herrschte nur noch über den Termin der Flucht. Da der Winter wieder einmal vor der Tür stand, mußten wir das Frühjar 1945 abwarten und unsere Vorbereitungen auf diesen Zeitpunkt konzentrieren. In der Zwischenzeit nahm das Lagerleben seinen vertrauten sturen Gang. Bis September 1944 erhielt ich immer noch Pakete von daheim und erst im Oktober dieses Jahres stellte man die Zahlungen an die Gefangenen von deutscher Seite ein, so daß wir auf unseren Arbeitsverdienst angewiesen waren, wenn wir uns etwas in der Kantine kaufen wollten; natürlich trugen die erwähnten kleinen Geschäfte mit den Kanadiern dazu bei, daß wir eigentlich nie ganz auf dem Trockenen saßen. Im Sommer hatte ich sogar ein Paket von der deutschen Kriegsmarine erhalten, ein ziemlich umfangreiches, daß eine komplette blaue Fähnrichsuniform, ein Khaki Jackett, schwarze Halbschuhe, 2 weiße Hemden, eine Schirmmütze und einen blauen Uniformmantel enthielt. Ungeanthe Schätze für einen Gefangenen. Auch hier ein Beweis, daß die Marinebürokratie bis zum bitteren Ende funktionierte.
Langsam aber sicher begann die lange Gefangenschaft und die Ungewißheit über die Zukunft Spuren bei nicht wenigen zu hinterlassen. Es gab die ersten Fälle, wo Depressionen zu Selbstmordversuchen oder zu beginnendem Wahnsinn führten. Ich erinnere mich an einen Maschinenmaat, der von morgens bis abends unter seiner Baracke lag, weil er dort, wie er angab, Schutz vor feindlichen Luftangriffen hatte. Er musste schließlich mit Gewalt aus seiner Deckung geholt werden, sonst wäre er dort unten verhungert. Man brachte ihn in eine Heil- und Pflegeanstalt. Mancher versuchte auch, verrückt zu spielen, in der Hoffnung auf diese Art und Weise nach Hause zu kommen. Das hat aber, soweit ich mich erinnern kann, niemand geschafft. Das beste Mittel Depressionen vorzubeugen war, sich zu betätigen. Außer der Arbeit im Busch gab es ausreichend Gelegenheit, sich in Kursen oder durch Selbststudium weiterzubilden und die Langeweile zu vertreiben und die meisten nutzten dies. Ich versuchte mich zur Abwechslung mit der schwedischen und der spanischen Sprache vertraut zu machen; viel ist davon jedoch nicht haften geblieben.
Daß die Kanadier einen frühen Winter erwarteten, schlossen wir aus der Bildung von Arbeitskommandos, die unter kanadischer Leitung unsere Baracken winterfest zu machen hatten. Da, wie schon erwähnt, unsere Baracken praktisch Pfahlbauten waren, bestand bei Schneefall natürlich immer die Gefahr, daß der Schnee unter die Baracken geweht wurde, und diese damit von unten zusätzlich in eine Art Kühlschrank verwandelte. Um das auszuschließen, wurden die Außenwände bis auf den Boden mit Brettern verschalt, so daß kein Schnee unter die Baracken gelangen konnte. Die verschalten Baracken hätten natürlich Tunnelbauern gute Voraussetzungen geschaffen, aber die gewitzten Kanadier hatten dem vorgebeugt indem sie an den Kopfenden der Baracken Luken in die Verschalung einbauten, durch die die Wachmannschaft täglich mit Taschenlampen bewaffnet unter die Baracken kroch um sicherzustellen, daß dort keine menschlichen Wühlmäuse zugange waren. Einige von uns, die liebend gern ihre überschüssigen Kräfte im Tunnelbau eingesetzt hätten, verdroß das sehr. So wurde beschlossen, die Schnüffler unter den Baracken einzusperren. Gesagt, getan! Mit Hammer und Nägeln bewaffnet wurde gewartet, bis der kontrollierende Kanadier unter der Baracke verschwunden war. Dann wurde blitzschnell die Luke verschlossen und festgenagelt. Nun saß die Maus in der Falle und versuchte vergeblich, sich zu befreien. Wir hatten unseren Spaß und übersahen dabei ganz, daß der heimtückisch eingesperrte ein älterer Herr war, der durch diesen Schreck beinahe einen Herzanfall erlitten hätte. Er wurde schließlich durch einen anderen Posten, der sein Geschrei hörte, aus seiner mißlichen Lage befreit und kroch unter dem Gelächter der versammelten POWs aus seinem Gefängnis heraus, nicht ohne uns zu verfluchen. Dieser Gag war natürlich nicht wiederholbar, denn von nun an nahmen zwei Kanadier die Kontrollen wahr. Einer kroch unter die Baracke und der andere stand vor der Luke Posten. In Erwartung des Winters wurden vor den Baracken große Vorräte von Brennholz aufgestapelt und ein freier Platz vor dem Lager wurde in eine riesige Holzlagerstätte verwandelt. Man muß sich einmal vorstellen, welcher Holzvorräte es bedurfte, um das Lager im Winter zu versorgen, denn anderes Heizmaterial als Holz gab es nicht. Die Holzversorgung hat aber immer ausgezeichnet geklappt, und kein POW ist in Kanada an Kälte zugrunde gegangen. Die Kojen in Ofennähe waren im Winter besonders begehrt, obwohl die Gefahr bestand, daß einem die Füße durch die bis zur Barackendecke glühenden Ofenrohre geröstet wurden.
Eines Morgens war es dann soweit. Der Frost hielt seinen Einzug und es schneite wie aus einem Sack. Der kanadische Winter war da und sollte uns monatelang erhalten bleiben. In den frostklaren Nächten waren zwei Geräusche besonders gut wahrzunehmen. Deutlich hörten wir die Sirenen der Eisenbahnzüge, die auf ihrem Weg von Ottawa nach North Bay Petawa unsere Gegend passierten, obwohl zwischen dem Lager und der Eisenbahnstrecke Meilen um Meilen kanadischer Wildnis lagen. Hannes Schwede, mein Partner bei der beabsichtigten Flucht, pflegte dann immer zu sagen: „Will, da fährt unser Zug nach North Bay.“ Das andere Geräusch ging einem ganz schön auf die Nerven und war vorwiegend in den Vollmondnächten zu hören. Da klagten und heulten die Timberwölfe den Mond an; ein schaurig-schöner Gesang, in den wir oft mit einstimmten. Zu Gesicht bekamen wir die vierbeinigen Musikanten jedoch nie, dafür aber andere und erheblich größere Vierbeiner. Baribals, kanadische Schwarzbären aus dem Algonquin Provinicial Park, beehrten das Lager mit ihrem Besuch und machten sich über die Abfalltonnen vor der Küche der Wachmannschaften her, um sich vor ihrem Winterschlaf den nötigen Speck anzufressen. Wir konnten sie deutlich ausmachen und die Kanadier ließen sie gewähren; vermieden es aber, ihnen zu nahe zu kommen. Man sagte uns, daß der Baribal im Gegensatz zu seinem erheblich größeren braunen Artgenossen, dem Grizzly, ein friedlicher Zeitgenosse sei, riet uns aber ab, seine Friedfertigkeit auf die Probe zu stellen, sollte uns einer der schwarzen Gesellen im Busch bei der Arbeit über den Weg laufen. Grizzlies gab es, dem Himmel sei Dank, in diesem Teil Kanadas nicht. Sie waren weiter im Nordwesten zuhause und konnten uns nicht gefährlich werden.
Der Winter hatte aber auch für uns POWs ( Prisoner of War ) seine guten Seiten. Das Einsetzen der Frostperiode bedeutete für uns eine Intensivierung der Arbeiten im Busch. Der Holzeinschlag hatte mit Winterbeginn seine Konjunktur und die Zahl der Arbeitsgruppen, die zum Holzeinschlag eingesetzt wurden, erhöhte sich beträchtlich. Jeder, der arbeiten wollte, bekam jetzt Gelegenheit dazu. Die Beschäftigung an der frischen Luft war nicht nur gut für unsere körperliche Verfassung, sondern machte auch Spaß. Wir arbeiteten meist in Teams von vier Mann, und es war nur natürlich, daß sich diese Teams aus Leuten zusammensetzten, die sich mochten und gut miteinander auskamen. Willi Dehler, Willi Grap, Max Vollmer und ich bildeten stets eine solche Gruppe, und wir hatten trotz der anstrengenden Arbeit viel Spaß. Der moderne Holzfäller unserer Tage würde lächeln, wenn er uns damals gesehen hätte. Da waren keine Maschinen im Einsatz, alles wurde von Hand gemacht und verlangte eine gute körperliche Konstitution. Manchmal arbeiteten wir den ganzen Tag, um nur einen der Baumriesen mit unseren zwei Meter langen Zugsägen und zweischneidigen Äxten zu fällen, und der Ruf „timber“, der seinen Fall ankündigte, klang dann wie ein Triumphgeschrei. Wir hatten es mit viel Schweiß geschafft, seiner Herr zu werden, das erfüllte uns mit Befriedigung und Stolz. Dann gönnten wir uns eine wohlverdiente Pause. Setzten uns an ein Feuer, das morgens mit Eintreffen auf der Arbeitsstelle angemacht wurde, tranken einen starken, heißen Kaffee mit viel Kondensmilch und Zucker und frischten unsere Lebensgeister wieder auf. Als Zwischenmahlzeit brieten wir uns ein paar Eier mit viel Speck in selbstgebastelten Pfannen oder einfach in den mitgeführten Schneeschaufeln. Niemand trieb uns an, und das hätte auch keinen Zweck gehabt: Wir hätten auf stur geschaltet und die Lumber Company, für die wir arbeiteten, hätte nur Verluste eingefahren. Einmal gab es einen solchen Fall, ein kanadischer Vormann wollte uns zu schnellerer Arbeit antreiben. Er biss dabei aber auf Granit. Die Arbeitsgruppen kamen nämlich zusammen, legten ihr Werkzeug auf einen Haufen und ließen dann einen großen Baum auf die ganze Bescherung fallen. Das war das Ende der Arbeit für diesen Tag und man fuhr uns ins Lager zurück. Da man uns aber brauchte, waren wir am nächsten Tag wieder draußen; nur den eifrigen Vormann trafen wir nicht mehr an. Das Beispiel zeigt aber auch, wie gutmütig die Kanadier im Umgang mit uns jungen Teufeln waren. Unvorstellbar, daß so etwas in russischer oder deutscher Kriegsgefangenschaft möglich gewesen wäre.
Besonderen Spaß machte uns unsere Arbeit, wenn die Arbeitsstelle an einem der zahllosen Seen gelegen war. Dann fanden wir uns in der Mittagspause auf dem zugefrorenen See ein, hackten Löcher ins Eis und bereicherten unseren Speisezettel mit frischem Fisch, den wir mit selbstgefertigten Angeln aus dem Wasser geholt hatten.
Der Abtransport des eingeschlagenen Holzes war nicht sehr kostspielig. Die „logs“( Holzstämme ) wurden mit Hilfe von Pferden zum nächsten Fluß geschleppt, dem Wasser anvertraut und schwammen dann zu ihrem Bestimmungsort, in den meisten Fällen ein Sägewerk. Eine Zeitlang hatten die Sägemühlen allerdings einen großen Verschleiß an Sägeblättern. Auf geheimnisvollen Wegen wurden die im Holzeinschlag Beschäftigten durch das deutsche Generalslager angewiesen, die Arbeit zu sabotieren. Unsere Sabotage bestand darin, daß wir uns lange Nägel beschafften und diese in die „logs“ schlugen. Wenn die „logs“ dann ins Sägewerk gelangten, flogen natürlich die Zähne aus Kreis- oder Bandsägen. Diese an sich einfältige Maßnahme, dem Feind zu schaden, hatte nicht lange Bestand. Man machte uns klar, daß die Arbeit engestellt würde, wenn wir nicht von diesem Unsinn Abstand nähmen. Bei einer Güterabwägung kam unser Lagerführer zu dem Ergebnis, daß wir durch unsere Sabotage dem Feind nur unwesentliche Nadelstiche versetzten, auf der anderen Seite aber ein Eingesperrtsein im Lager sich sehr negativ auf die Moral und die körperliche Verfassung der POWs auswirken würde. Wir stellten also diese Maßnahme wieder ein.
So verging die Zeit bis Weihnachten 1944 wie im Fluge. Kurz vor Weihnachten aber erlebten wir eine besondere Überraschung. Die kanadischen Zeitungen, die wir im Lager erhielten, waren plötzlich besonders auf ihren Titelseiten mit sehr viel Zensurschwärze versehen, ein untrügliches Zeichen, daß sich etwas ereignet hatte, das für die Alliierten so negativ aussah, daß man es den Kriegsgefangenen vorenthielt. Wir bekamen aber sehr schnell heraus, was wirklich anlag. Da wir draußen mit kanadischen Zivilisten zusammenarbeiteten und auch unsere Posten Zeitungen mit in den Busch brachten, war es bald kein Geheimnis mehr, daß die deutsche Wehrmacht an der Westfront zu einer Großoffensive angetreten war, die zumindest im Anfangsstadium viel Erfolg hatte und den Alliierten Kopfzerbrechen bereitete. Da sich die Gefangenen an alles, was den Krieg für uns positiv gestaltete, klammerten und Gerüchte aus Mücken Elefanten werden ließen, war unser Jubel sehr groß; wir sahen eine Wende des Krieges unmittelbar bevorstehend. Das Weihnachtsfest 1944 wurde von diesem Ereignis geprägt, wir verlebten es in Hochstimmung. Markige Reden wurden gehalten und Siegeslieder gesungen. Dem Hoch folgte jedoch bald ein Tief, als sich die deutsche Offensive bei Bastogne festlief und einsetzendes gutes Flugwetter den Alliierten ermöglichte, ihre Luftüberlegenheit geltend zu machen. Die Ardennenoffensive endete als Fehlschlag; das Beste, was die deutsche Wehrmacht noch einmal auf die Beine gestellt hatte, war in einer sinnlosen Offensive verheitzt und ausgeblutet und das Ende des Krieges war nur unwensentlich hinausgeschoben worden. Die Folge war die weitere Zerstörung deutscher Städte und enorme Verluste unter der Zivilbevölkerung.
Wir liefen enttäuscht umher und vielen von uns dämmerte zum ersten Male, daß wir wohl im Begriff waren, den Krieg zu verlieren. Aber noch wagte keiner, dies öffentlich zu äußern. Er wäre seines Lebens nicht mehr froh geworden und hätte sich in die Obhut der Kanadier begeben müssen. In einem anderen Lager hatte man sogenannte Defaitisten ermordet. Aber auch in unserem Lager blieb die Niederlage nicht ohne Wirkung. Drei Mannschaftsdienstgrade waren plötzlich aus dem Lager verschwunden und wohnten nur in einer Baracke der Wachmannschaften. Sie waren zur anderen Seite übergelaufen und hatten sich vorsorglich in den Schutz der Kanadier begeben. Es handelte sich um zwei ältere Männer, von denen man munkelte, daß sie einmal der kommunistischen Partei Deutschlands angehört hatten. Der dritte war ein einfältiger Bursche, der mit einem dieser beiden befreundet war. Die Reaktion im Lager war typisch für unseren Geisteszustand. Wo immer die drei sich zeigten und vom Lager aus gesehen werden konnten, wurden sie mit Geschrei und Steinwürfen verjagt. Verräter und Schweine waren sie in den Augen der Mehrheit der Lagerinsassen, denen man mit Verachtung begegnen musste.
So gingen wir mit gedämpfter Stimmung in das letzte Kriegsjahr. Immer noch glaubten wir aber, daß die V-Waffen ein für uns günstigen Ausgang des Krieges bewirken könnten. So trotteten wir Morgen für Morgen weiter in den Busch und gingen unserer unterbezahlten Arbeit nach.
Hannes Schwede und ich vergaßen aber nicht, was wir uns für das Frühjahr vorgenommen hatten und ließen keine Gelegenheit ungenutzt, unsere Ausrüstung für die Flucht zu vervollständigen. Aus einer Werkzeugkiste unserer kanadischen Holzfällerkollegen ließen wir eine große Kombizange mitgehen, die wir für das Durchschneiden der Drähte des Lagerzaunes benötigten. Wir stockten unseren Vorrat an kanadischer Währung auf und ließen uns von einem Mitgefangenen, der im Zivilberuf Schneider gewesen war, aus je zwei großkarierten, aber mit gelber Zielscheibe versehenen Hemden ein normales Zivilhemd schneidern. Die Wochenenden benutzten wir wieder und wieder zum Festlegen der günstigsten Stelle für den Ausbruch aus dem Lager. Schließlich kamen wir zu dem Entschluß, es auf der dem See zugewandten Längsseite des Lagers zu versuchen und zwar unmittelbar neben einem der Wachtürme. Die Gründe dafür waren folgende: Die außerhalb des Lagers zwischen Zaun und Seeufer verlaufende Straße besaß zum See hin eine fast senkrechte Böschung von ungefähr 80 cm Höhe, hinter der wir uns ungesehen bis über das Ende des Lagers hinaus vorarbeiten konnten, um dann im Busch zu verschwinden. Der Wachturm, den wir anvisiert hatten, unterbrach den zweiten Lagerzaun. Wenn man erstmal zum ersten Zaun gelangt war, konnte man vom Turm aus nicht mehr eingesehen werden und besaß eine gute Chance, beide Zäune zu überwinden. Kritischer Punkt waren also die 5 m, die unseren Rundkurs im Lager von dem ersten Zaun trennten. Ein unmittelbar neben unserem Rundkurs angebrachter Warndraht zeigte uns an, daß hinter dem Warndraht die Zone begann, deren Betreten verboten war. Zuwiderhandlungen konnten mit Waffengewalt unterbunden werden. Wir hatten uns aber eine Lösung des Problems einfallen lassen, unbemerkt an den ersten Zaun zu gelangen. Wir würden uns einer Gruppe von Runden-Drehern anschließen, während eine andere Gruppe ca. 60 m hinter uns einen Streit mit Lärm und Schlägerei vortäuschen sollte, um die Aufmerksamkeit des Postens auf dem Wachturm auf sich zu lenken. Die Verwirrung wollten wir benutzen, um über den Warndraht zu springen und so den ersten Zaun zu erreichen. Das klang ganz einleuchtend und schien eine 50 zu 50 Chance, unbemerkt an den ersten Zaun zu gelangen. Sollten wir bemerkt werden, so hofften wir, der Posten würde uns nicht gleich wie Hasen abschießen, wenn wir unsere Hände in die Höhe strecken und uns ergeben würden. So war endlich ein nach unserer Ansicht genialer Plan geboren; seine Durchführung würde zeigen, was er wirklich wert war. Anfang Mai hatten wir uns als Termin gesetzt, da bis dahin Schnee und Eis verschwunden sein würden. Im April bot sich eine gute Gelegenheit, den logistischen Teil des Unternehmens, die Bevorratung mit Lebensmitteln für die erste Fluchtwoche in Angriff zu nehmen. Unser Verpflegungszelt, das immer in unmittelbarer Nähe unserer Außenarbeitsstellen aufgebaut wurde, war beim Bezug einer neuen Arbeitsstelle ganz nahe der Straße Camp 33 – Petawawa errichtet worden. Wir beschlossen, in diesem Zelt Kartons mit Lebensmitteln, eine Axt, zwei Messer und weitere Utensilien, die wir für die Flucht benötigten, zu vergraben, um den schwierigsten Teil unserer Flucht, den Ausbruch aus dem Lager, mit so wenig Ballast wie möglich anzutreten. Da unser Fluchtweg in Richtung Norden entlang der erwähnten Straße führte, konnten wir ohne größeren Zeitverlust die vergrabenen Sachen aus dem Versteck aufnehmen. Wichtig war auch, daß wir ein Versteck für diese Sachen wählten, das wir auch bei Nacht ohne Schwierigkeiten finden würden. Wir wußten, daß das Verpflegungszelt bald an einen anderen Ort verlegt werden würde, da unsere neue Arbeit im Schlagen einer 50 m breiten Schneise bestand, die quer durch den Busch bis nach Chalk River führen und eine Hochspannungsstromleitung für die Elektrifizierung des Gebietes um Chalk River aufnehmen sollte. Das hatte man uns jedenfalls von kanadischer Seite erzählt und uns damit einen Bären aufgebunden, wie wir später feststellen konnten. Sicher, die Schneise nahm Hochspannungsmasten- und leitung auf. Sie diente jedoch nicht dem erwähnten Zweck, denn in Chalk River war man zu dieser Zeit nicht mehr auf Petroleumlampen angewiesen, sondern besaß bereits elektrisches Licht. Stattdessen sollte die neue Hochspannungsleitung eine dort im Bau befindliche Atomversuchsanlage versorgen. Es war klar, daß wir für diese Versorgung keinen Finger gerührt hätten, hätte man uns reinen Wein eingeschenkt. Einen Einfluß auf den Bau der ersten Atombombe wird Chalk River jedoch kaum gehabt haben, denn diese stellten die Amerikaner in ihrem eigenen Land her und brauchten dazu keine kanadische Hilfe.
Wir kämpften uns also durch den kanadischen Busch, und die Schneise wurde täglich um ein Beträchtliches länger. Die Arbeit machte Spaß, da wir lediglich alles, was sich da an Bäumen befand, fällen mußten, die Kronen der Bäume verbrannten, aber keine Logs zu schneiden hatten.
So blieb uns nicht viel Zeit, vor der ersten Verlegung des Verpflegungszeltes unsere Schätze zu verbuddeln. Nachdem wir uns die Genehmigung des deutschen Lagerführers eingeholt hatten, bestellten wir in der Lagerküche den Proviant, den wir benötigten. Der Küchenchef stellte alles zusammen, und es wurde in zwei separaten Pappkartons mit der Tagesverpflegung zum Zelt gebracht. Mit Hilfe der im Verpflegungszelt beschäftigten Prisoners wurde das, was wir benötigten, schnell unter die Erde gebracht. Wir markierten den Lagerplatz des vergrabenen Schatzes durch Kerben an zwei sich gegenüberstehenden Bäumen, in deren Fluchtlinie sich das Versteck befand, und legten zusätzlich ein paar Feldsteine unmittelbar auf das Versteck.
Wir hatten gut daran getan, uns zu beeilen, denn schon an einem der nächsten Tage wurde das Verpflegungszelt verlegt, um den Arbeitskolonnen näher zu sein. Hannes Schwede und ich arbeiteten weiter mit und warteten auf den Tag, an dem das Eis von Seen und Flüssen verschwunden sein würde. In der Zwischenzeit fraßen sich die Arbeitskolonnen Meile um Meile in den Busch hinein, und als wir eines Tages auf dem Kamm eines Hügels ankamen, konnten wir feststellen, daß sich in der Ferne ein anderer Lindwurm uns entgegenarbeitete. Das große Meeting mit dieser anderen Arbeitskolonne erlebten Hannes und ich nicht mehr, denn das Wetter kam unseren Plänen entgegen und das Eis verschwand in relativ kurzer Zeit von den Gewässern. Wir meldeten uns also aus unserer Arbeitskolonne ab und blieben bis zum Abend unseres Ausbruchs im Lager.
Dann kam der große Augenblick, auf den wir uns so lange und gründlich vorbereitet hatten. Der Abend des bewußten Tages war wie für die Flucht bestellt. Wir hatten Neumond und der Himmel war wolkenverhangen. Sollte es uns gelingen, aus dem hell erleuchteten Lager hinauszukommen, würden wir, von der Dunkelheit der kanadischen Nacht verschluckt, untertauchen. Alles war bestens organisiert. Die beiden Gruppen, die uns behilflich sein sollten, um Deckung und Ablenkung zu gewährleisten, waren bereit und setzten sich auf ein verabredetes Zeichen hin in Bewegung. Als wir beide mit der Gruppe, die uns Deckung gab, in Höhe „unseres“ Wachturms angekommen waren, inszenierte die Gruppe, die uns in ca. 80 m Abstand folgte, die verabredete Schlägerei, um den Posten auf unserem Turm abzulenken. Kaum hatte sich das Tarngeschrei erhoben, sprangen Hannes Schwede und ich über den Warndraht und warfen uns vor dem ersten Zaun zu Boden. Mit rasendem Puls lagen wir dort eine Minute lang bewegungslos und warteten auf den Alarmschrei der Posten. Aber es geschah nichts. Anscheinend war es uns gelungen, unbemerkt an den Zaun zu gelangen. Durch Gesten verständigten wir uns, daß nun der zweite Schritt unseres Unternehmens beginnen sollte. Hannes machte sich daran, mit der geklauten Drahtschere ein genügend großes Loch in den Stacheldrahtzaun zu schneiden, der aus einem Geflecht von senkrechten und waagerechten Drähten bestand. Wegen des grobmaschigen Geflechts waren nicht viele Schritte erforderlich. Da der Draht aber eine starke Spannung hatte, lösten die Schnitte beim zerspringen ein ziemlich lautes Geräusch aus. Uns kam es vor, als müsste jeder Knall Meilenweit gehört werden, und wir schwitzten vor Angst. Aber, unsere Flucht schien unter einem günstigen Stern zu stehen. Auf unserem und den benachbarten Türmen blieb alles ruhig. Endlich war der letzte Schnitt getan, und wir krochen durch das Loch über den geharkten Sandstreifen, der sich zwischen beiden Zäunen befand, zu unserem Turm und dem zweiten Zaun, der uns noch von der Freiheit trennte. Wir erreichten den Schatten des Turms und hielten für einen kurzen Augenblick an, um Atem zu holen. Dann zwinkerten wir uns zu und nahmen den nächsten Schnitt in Angriff. Der zweite Zaun war wie der erste gebaut und an seiner Rückseite zusätzlich durch Stacheldrahtrollen verstärkt. Wie geplant, schnitt Hannes zuerst die Drähte durch, die am Turm befestigt waren. Auch hier wieder das nervtötende Geräusch beim zerspringen. Endlich war ein Loch geschnitten; groß genug, um hindurchkriechen zu können. Zunächst mussten wir aber noch mit der Stacheldrahtrolle fertigwerden, dem letzten Hindernis vor der Freiheit. Ich nahm eine kurze Atempause wahr, um einen letzten Blick auf das Lager zu werfen. Was ich sah, beruhigte mich. Die Rundendreher zogen scheinbar unbeeindruckt von den beiden Gestalten, die sich am Zaun zu schaffen machten, ihre Bahn. Keiner schaute zu uns hin, um nicht den Verdacht der Posten zu wecken. Unser Frühwarnsystem hatte sich anscheinend bewährt. Bereits 100 m vor dem Turm wurden die Rundendreher darauf aufmerksam gemacht, daß sie das, was sich am Zaun vor dem nächsten Turm abspielte, ignorieren sollten, um uns nicht zu gefährden. Diese Maßnahme war natürlich ein zweischneidiges Schwert. Der Mensch ist ein neugieriges Wesen, und wenn man ihn anweist, keinen Blick auf ein an sich kein alltägliches Ereignis zu werfen, ist man nicht sicher, ob er nicht nun erst recht sehen will, was geschieht. Es blieb aber niemand stehen, man riskierte wohl nur einen unauffälligen Blick, der dem Turmposten nicht auffiel.
Hannes hatte inzwischen festgestellt, daß die Stacheldrahtrolle nicht am Turm befestigt war; man konnte sie einfach zur Seite schieben und ohne Schwirigkeit zwischen ihr und der Turmwand ins Freie gelangen. Er hielt sie zuerst für mich fest, und ich konnte ohne Kratzer auf die andere Seite, die Seite der Freiheit, gelangen. Dann tat ich das gleiche für ihn und in wenigen Sekunden hatte auch er das letzte Hindernis passiert. Wir setzten uns an die Rückwand des Turms und grinsten uns freudestrahlend an. Der Rest, so glaubten wir, wäre nur noch ein Kinderspiel. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Zunächst jedoch lief alles gut, als wir uns aus dem Schutz des Turms lösten, über den Fuhrweg robbten und hinter der Böschung zum See verschwanden. Hier konnten wir von keinem Scheinwerferstrahl erfaßt werden und es konnte uns auch niemand von irgendeinem Turm her ausmachen. Wir hatten etwa 200 m bis zum Ende des Lagers, der schmalen Spitze des Eies, im Schutze der Böschung zurückzulegen und wollten dann hinter dem letzten Turm über die schon erwähnte Straße, die vom Lager in die Zivilisation führte, springen und im Busch verschwinden. Die ersten 50 m waren schnell überwunden, und alles lief nach Plan. Dann entdeckte ich zu meinem Entsetzen, daß vor mir ein Hindernis auftauchte. Es bestand aus Baumstämmen, den die Kanadier für eine noch durchzuführende Arbeit zur Befestigung der Uferböschung am Rande des Weges abgeladen hatten. Die Mehrzahl der Stämme war über die Böschung in den See gerollt und hatte unsere Deckung, den toten Winkel zwischen Straße und See, zunichte gemacht. Ich machte Hannes, der hinter mir her gekrochen war, auf die neue Lage aufmerksam und schlug vor, den Rest der Strecke bis zum Lagerende auf allen vieren im flachen Wasser kriechend möglichst schnell zurückzulegen. Er nickte mit dem Kopf, und ich machte mich auf den risikoreichen Weg, denn nun konnten wir wieder von unserem und dem Turm mit der Galerie am Ende des Lagers bemerkt werden, wenn einer der Posten auf den Gedanken kam, mit einem beweglichen Scheinwerfer das Gelände hinter den Zäunen auszuleuchten. Zunächst schien alles gut zu gehen. Schweißgebadet und vom Seewasser zusätzlich durchnäßt erreichte ich in sehr kurzer Zeit das Ende des Lagers in Höhe des dort befindlichen Wachturms. Hier waren auch keine Baumstämme mehr in den See gerollt; ich atmete auf, denn der Rest, der Sprung über die Straße bei genügender Entfernung von dem Turm, schien ohne Risiko. Es machte mich nur stutzig, daß ich nicht mehr den Atem von Hannes in meinem Nacken spürte, irgendwas mußte ihn aufgehalten haben. Zu allem Unglück wurde jetzt auch noch auf dem Turm eine Tür geöffnet, und der Posten betrat die Galerie. Ich hörte ganz deutlich das Quietschen der Tür und die Schritte des Postens auf den hölzernen Planken. Obwohl ich ihn von meiner Deckung aus, hinter der ich mich ganz klein gemacht hatte, nicht sehen konnte, war die Melodie des Lides, das er pfiff, unverkennbar: „Pack up your troubles in your old kitbags and smile, smile, smile!“ Dieses Lied war ein Hit der Briten und Kanadier im ersten Weltkrieg gewesen und bei den Veteran Guards of Canada, die alle diesen Krieg mitgemacht hatten, sehr beliebt. Als ich hörte, daß sich seine Schritte zum anderen Ende der Galerie entfernten, setzte ich schnell meinen Weg fort, ohne auf Hannes zu warten. Dann vernahm ich das Klappen einer Tür auf dem Turm, und vermutete, daß der Posten es vorgezogen hatte, wieder die Wärme des Turminneren gegen die Nachtkühle draußen zu tauschen. Ich spannte meine Muskeln an, erhob mich und raste über die Straße in das schützende Dunkel des Busches, nicht ohne dabei über einen Ast zu stolpern und ziemlich schmerzhaft zu Boden zu gehen. Da lag ich nun und wartete auf meinen Kumpel. Aber Hannes kam nicht. Stattdessen erhob sich plötzlich gellendes Geschrei vom Turm am Ende des Lagers: „Halt, who goes there, hands up!“ Schüsse peitschten durch die Nacht und ich dachte: Hannes, du armer Hund, jetzt hat man dich am Arsch.“ Ich hoffe nur, daß die Schüsse nicht gezielt abgegeben worden waren, sondern nur zur Alarmierung der anderen Posten dienten und der Aufforderung zum „Hände hoch“ Nachdruck verleihen sollten. So war es glücklicherweise auch gewesen, wie ich später in Erfahrung bringen konnte. Was aber war geschehen, daß Hannes nicht so schnell wie ich im flachen Wasser des Centre Lake Boden gut gemacht hatte und deshalb länger der Gefahr, entdeckt zu werden, ausgesetzt gewesen war? Ganz einfach, er hatte geglaubt, beim kriechen auf allen vieren ein deutliches Ziel für die Posten abzugeben und war weiter gerobbt, und das war natürlich eine zeitraubende Angelegenheit, die ihm schließlich zum Verhängnis wurde. Ich wußte jetzt, daß ich meinen Fluchtbegleiter verloren hatte und auf mich allein gestellt war. Der Gedanke aufzugeben kam mir jedoch in keinem Augenblick. Ich fluchte vor mich hin, murmelte: „Scheiße“ und nochmal „Scheiße“, dann aber erinnerte ich mich, daß Eile geboten war. In weitem Bogen umging ich die kleine Blockhütte am Schlagbaum, der die Straße absperrte, weil ich sah, daß man dort die ganze Sache mitbekommen hatte und die Gegend beobachtete, soweit das in der Dunkelheit mit einem einzigen Scheinwerfer möglich war. Die einzige Aussicht auf Erfolg bot dabei die Straße, da der dichte Urwald unmittelbar neben der Straße begann und kein noch so starker Scheinwerfer dieses Dickicht durchdringen konnte. Ich schlug also einen Bogen durch das Gehölz. Als ich später wieder auf die Straße stieß, schlug ich eine Gangart ein, die mir noch aus meinen Karl-May-Büchern geläufig war: 100 Meter Trab, dann 100 Meter schnelles Gehen und dann dasselbe von vorn. Damit gewann man Boden und geriet doch nicht so schnell aus der Puste, als wenn man versucht hätte, nur zu rennen. Ich wußte, daß ich nur wenige Kilometer bis zum Versteck der Lebensmittel und der Fluchtausrüstung zurückzulegen hatte, es kam darauf an, dieses Versteck möglichst schnell zu erreichen und dann mit allem versehen, weiter nach Norden zu marschieren. Ich nahm mir aber die Zeit zu kurzen Verschnaufpausen und um mich umzusehen und in der Ferne den Lichtschein des hellerleuchteten Lagers zu betrachten. Dabei hatte ich ein überwältigendes Gefühl, das sicher nur der verstehen kann, der nach langem Eingesperrtsein die Luft der Freiheit atmet. Ich freute mich wie ein Kind zu Weihnachten. „Mann, du hast es geschafft“, dachte ich, „du bist draußen!“ Wie oft hatte ich es schon mit anderen Kameraden versucht, und jetzt endlich war es geglückt! An das, was mir allein auf weiter Flur bevorstand, verschwendete ich in diesem Augenblick keinen Gedanken; das Erfolgsgefühl beherrschte mich ganz und verdrängte alles andere.
Während ich im Schweinsgalopp weiter meinem Ziel zustrebte, bemerkte ich plötzlich hinter mir Motorenlärm und das Scheinwerferlicht von Kraftwagen. Die Verfolger hatten sich also auf meine Fährte gesetzt und waren dabei, ihre Kontrollpunkte zu erreichen und zu besetzen. Die Gefahr, von den Fahrzeugen aus entdeckt zu werden, war aber gleich null. Rechtzeitig genug verließ ich die Straße und legte mich einige Schritte von ihr entfernt auf den Waldboden. Von meinem Versteck aus sah ich die Fahrzeuge kommen und vorüberfahren. Ich hörte sogar das zornige Fluchen der alten Herren, die um ihre Nachtruhe gebracht worden waren. Von einem Gefangenen, der das Dienstzimmer des Intelligence Officers gereinigt hatte, wußten wir, daß sich dort eine Karte befand, auf der alle Punkte markiert waren, die bei der Flucht eines Gefangenen automatisch besetzt wurden, um den Flüchtenden schneller aufzugreifen. Wie er berichtet hatte, handelte es sich bei diesen Punkten vorwiegend um Straßen, die aus dem Busch hinausführten, Brücken über nicht allzuweit vom Lager entfernte Flüsse und auch die Bahnhöfe bis zu einer gewissen Entfernung vom Lager. Das Sicherheitssystem war wie ein Spinnennetz aufgebaut, in das sich das Opfer verstricken und zur Strecke gebracht werden sollte. Leider war es dem Kameraden nicht gelungen, diesen Plan auf eine Karte zu übertragen. Wichtig war aber schon die Nachricht über das Bestehen eines solchen Plans; man war gewarnt und konnte diese kritischen Punkte umgehen. Nachdem die Wagenkolonne vorübergebraust war, verließ ich meine Deckung und setze meinen Weg auf der Straße fort. Ich brauchte aber zunächst keine besondere Vorsicht walten zu lassen, da es bis zur Lagerstätte der Fluchtverpflegung und des Geräts keinen markanten Punkt, keine Straßenkreuzung und keine Brücke mehr gab. Ich glaubte nicht, daß sich die Kanadier abseits von „key points“ auf die Lauer legen würden und behielt damit recht. Auf meinem Weg versuchte ich mir vorzustellen, was sich wohl im Lager seit meinem Ausbruch abgespielt hatte. Ich lag mit meinen Vermutungen richtig. Nachdem man Hannes festgenommen hatte, wurde das Lager sofort von einer großen Anzahl Kanadier besetzt; die Gefangenen in ihre Baracken getrieben. Von Hannes bekam man kein Wort über etwaige Spießgesellen, die neben ihm an dem Ausbruch beteiligt waren, heraus. Er nervte stattdessen seine Vernehmer mit der stereotypen Antwort: „Ich spreche kein Englisch und habe meinen Namen vergessen“. So musste man, um seine Identität festzustellen, erst einmal in der Lagerkarte das Karteiblatt heraussuchen, in dem außer den Personalien, Wehrmachtsteil und besonderen Kennzeichen auch ein Verbrecherfoto des Betreffenden war. In der Zwischenzeit hatte man begonnen die Baracken auf Vollzähligkeit zu überprüfen, ein umständliches Verfahren, da die Gefangenen in ihren Baracken wie Bienen in einem Bienenkorb durcheinanderschwirrten, um den Kanadiern das Zählen der Häupter ihrer Lieben zu erschweren. So kamen sie schließlich auf die geniale Idee, die Gefangenen einzeln aus ihren Baracken heraustreten zu lassen und auf diese Weise festzustellen, wieviele POWs sich wirklich in der Baracke befanden. Nach geraumer Zeit fanden sie heraus, daß nur ein POW fehlte und stellten schließlich auch fest, wer dieser war: Ich. Wilhelm, Max, Walter, Georg Rahn, Oberfähnrich der Deutschen Kriegsmarine, vom Montreal Daily Star in einer seiner nächsten Ausgaben wie folgt beschrieben: „A fanatical young german Nazi POW, W.H. Rahn, has escaped from the Petawawa POW Camp, and is still at large.“ Während also im Camp 33 noch große Konfusion herrschte, man die Ausbruchsstelle gefunden hatte und einen den Veteran Guards zugehörigen Indianer, den wir „Old Sitting Bull, den Rasierwassersäufer“ getauft hatten, weil er so scharf auf das von uns in unserer Kantine verkaufte alkoholhaltige Rasierwasser war, als Fährtensucher eingesetzt hatte, trabte ich weiter meinem ersten Ziel, dem Versteck der Lebensmittel entgegen. Zu Sitting Bulls Ehrenrettung muss erwähnt werden, daß er tatsächlich den Punkt fand an dem ich die Straße nach Petawawa wieder errreichte. Dafür soll er der Lagergerüchteküche zufolge eine Extraration Rum von seinem Kompaniechef erhalten haben. War es wirklich so? Wer weiß, und die Veterans Guards kann man nicht mehr befragen, die haben sicher längst alle das Zeitliche gesegnet. Nach relativ kurzer Zeit erreichte ich den markanten Punkt, den wir uns für das Auffinden des Verstecks eingeprägt hatten – eine ziemlich scharfe Straßenkurve, hinter der sich auf der linken Seite eine kleine Lichtung befand, auf der wir damals das als Versteck vorgesehene Verpflegungszelt aufgeschlagen hatten. Mehr Mühe machte es mir schon, die beiden eingekerbten Bäume und die Steine zu finden, die den Platz, an dem wir die beiden Kisten der Erde anvertraut hatten, markierten. Aber ich fand sie und legte die beiden Kisten mit meinen bloßen Händen und der Zuhilfenahme von Holzstücken zum Graben frei. Nur gut, daß wir sie nicht metertief vergraben, sondern nur eine Grube ausgehoben hatten, die so tief war, daß sie die Kisten aufnehmen konnte. Das Ganze war dann mit einer dünnen Erdschicht abgedeckt worden. Ich war ganz überwältigt vor Freude, als ich die beiden Kisten unversehrt ans Tageslicht förderte wobei ich die Schätze mehr fühlte als sah. Da die Lebensmittel für zwei Personen berechnet waren, und ich sie unmöglich allein transportieren konnte, schlug ich mir erst einmal von dem für Hannes zugedachten Teil den Bauch voll, ehe ich den Rest nebst Karton wieder fein säuberlich der Erde anvertraute. Man konnte ja nicht wissen, ob ein anderer noch einmal auf sie zurückgreifen wollte. Außer einer Armeetasche mit ausgewählten Lebensmitteln nahm ich eine Axt, ein Messer und das Wichtigste, einen selbstgebastelten Kompaß, mit. Meine POW Kleidung tauschte ich mit einem Ziviloverall, einem dicken großkarierten Holzfällerhemd und einem blauen Isländer. So unterschied mich nichts mehr von einem kanadischen Lumberjack, der auf dem Weg in ein anderes Holzfällercamp ist. Das glaubte ich jedenfalls. Dann setzte ich gesättigt und wohlgelaunt meinen Weg entlang der Straße nach Norden fort. Die Nacht war ziemlich dunkel; ich konnte die Straße jedoch gut erkennen, ich brauchte nur nach oben zu schauen, um den Himmel zwischen der dunklen Wand des Waldes auf beiden Seiten zu sehen. Außer dem Geräusch, das der Wind in den Wipfeln der Bäume verursachte und dem gelegentlichen Schrei eines Nachtvogels war es totenstill. Deutlich vernahm ich jedoch das Keuchen meiner Lunge und das Geräusch, das meine Schuhe auf der Straße verursachten. Die Zeit verrann; ich musste schon etliche Meilen zurückgelegt haben und konnte dennoch, wenn ich mich umblickte, den hellen Schein des Lagers am Himmel sehen. Dann nahmen meine an die Dunkelheit gewöhnten Augen etwas wahr, das meine gespannte Aufmerksamkeit erregte. In ziemlich großer Entfernung vor mir waren auf der Straße mehrere Lichtquellen auszumachen, eine größere und mehrere kleine. Da die größere wieder verlosch, die kleineren aber blieben, folgerte ich, daß jemand eine Taschenlampe benutzt haben mußte und die kleinen Lichtpunkte von Rauchern herrührten, die entweder Zigaretten oder Zigarren im Mund hatten. Vorsichtshalber verdrückte ich mich erst einmal im Busch und überlegte, was zu tun war. Ich hatte keinen Zweifel, daß ich auf eine Straßensperre an einem der Punkte des Alarmplanes gestoßen war. Hätten die Brüder sich nicht so unvorsichtig im Umgang mit Lichtquellen verhalten, wäre ich ihnen sicher direkt in die Arme gelaufen. Ich beschloß, das Ganze einmal aus der Nähe zu betrachten, entledigte mich des Ballastes meines Gepäcks und schlich mich wie ein Indianer auf dem Kriegspfad an die Sperre heran. Je näher ich kam, desto sicherer wurde ich, daß es sich wirklich um eine Straßensperre der Veterans Guards handelte. Die alten Burschen benahmen sich nicht sehr diszipliniert; ziemlich laut erzählten sie sich Stories und qualmten dabei munter vor sich hin. Ich stellte aber auch fest, daß sie auf einer Brücke über einem Wasserlauf postiert waren, von dessen Existenz wir bei unserer Fluchtplanung keine Ahnung gehabt hatten. Vorsichtig schlich ich mich also wieder zu meinen Sachen zurück, nahm sie auf und beschloß, in genügend weitem Abstand von der Brücke durch den Busch an den Wasserlauf zu gelangen. Dabei hatte ich jedoch meine Rechnung ohne den Wirt, den kanadischen Busch, gemacht. Es war einfach unmöglich, ihn in der Dunkelheit der Nacht zu durchqueren. Nachdem ich mich ein paar Mal auf die Nase gelegt hatte, über Äste oder Wurzeln gestolpert und schließlich in eine Mulde gefallen war, gab ich mein nächtliches Unterfangen auf und suchte mir einen einigermaßen trockenen Platz, um einige Stunden zu schlafen und beim Morgengrauen meinen Weg fortzusetzen. Ich hatte mich aber kaum hingelegt, da deutete mir ein Rascheln an, daß ich nicht sein einziger Bewohner war. Wie vom Blitz getroffen sprang ich auf und mein erster Gedanke war: „Mensch, hier gibt es doch Bären!“ Oft genug hatten wir sie ja an den Küchenabfalltonnen der Wachmannschaften vor dem Lager gesehen. Nun tat ich etwas, was mir im Nachhinein sehr lächerlich erschien, weil es absolut sinnlos war. Ich suchte mir einen geeignet erscheinenden Baum, erklomm ihn und errichtete mir auf einem dicken Ast eine Schlafstätte für den Rest der Nacht ein. Um nicht im Schlaf wie ein reifer Apfel hinunterzufallen, band ich mich mit zwei Lederriemen am Stamm fest. Ich übersah dabei, daß man den Baribals nachsagt, geübte Kletterer zu sein, die so manches Pfund Honig in luftiger Höhe erbeuten. Jedenfalls fühlte ich mich im Augenblick sicher vor Annährungsversuchen von Bären oder anderem Raubzeug. Außer gelegentlichem Einnicken war es mit dem Schlaf in dieser unbequemen Position jedoch schlecht bestellt und so kletterte ich beim ersten Büchsenlicht ziemlich zerschlagen von meinem Hochsitz herab. Nach einem ausgiebigen Frühstück machte ich mich dann wieder auf den Weg nach Norden. Mein primitiver Kompaß funktionierte zwar recht gut, aber man mußte ihn absolut ruhig halten, damit sich die magnetische Nadel, die freischwebend auf einem Korken befestigt war, einpendeln konnte. Das war etwas mühselig, und so beschloß ich, mich der Straße wieder so weit zu nähern, daß sie mir als Anhaltspunkt zum Erreichen des Wasserlaufs dienen konnte. In bester Pfadfindermanier pirschte ich mich also vorwärts, bis ich die Stimmen der an der Brücke postierten Kanadier ausmachte. Um ganz sicher zu gehen, daß sie mich nicht entdecken konnten, schlug ich mich seitwärts in die Büsche und hatte keine Mühe, ein paar hundert Meter von der Brücke entfernt wieder an den Wasserlauf zu stoßen, der das erste natürliche Hindernis auf meinem Weg zur Eisenbahnlinie war. Der Wasserlauf war nicht übermäßig breit, vielleicht 15 – 20 Meter und kein River im kanadischen Sinne, aber er war tief und naß genug und würde ausreichen, um meinen Proviant zu verderben und mich für den Rest des Tages in feuchten Sachen marschieren zu lassen. So wanderte ich erst einmal an seinem südlichen Ufer eine Strecke herunter und entfernte mich immer weiter von der Straße samt der dazugehörigen Brücke, immer in der Hoffnung, eine Furt zu finden. Die Helden meiner Indianerbücher hatten so etwas immer parat, aber meine Wirklichkeit sah anders aus. Keine Furt weit und breit, im Gegenteil, der Wasserlauf schien immer breiter zu werden, je weiter ich mich von der Straße entfernte. Was hätten meine Waldläufer in einem solchen Fall getan? Ganz einfach, sie hätten sich ein Floß gebaut, ihre Habseligkeiten darauf gelegt und wären nackt, das Floß vor sich herschiebend, über reißende Ströme jeglicher Größe geschwommen. Was die konnten, war also auch kein Problem für mich. Ich suchte mir ein paar geeignete dünne Bäume, fällte sie fachmännisch – das hatte ich ja inzwischen gelernt – und band sie mit Schnur, die zu meinem Fluchtgepäck gehörte zu einem Floß zusammen, das groß genug war, um meine Provianttasche, mein Werkzeug und meine Kleidung zu tragen, ohne daß diese naß werden würden. Da der Morgen empfindlich kühl, und deshalb nicht besonders für Nacktkultur geeignet war, begab ich mich mit meinem Floß schnellstens in die eiskalten Fluten und schwamm mit lautem Zähneklappern – ein Wunder, daß die Posten es nicht wahrnahmen – mein Floß vor mich herschiebend durch den Fluß. Wie der Blitz war ich am anderen Ufer aus dem Wasser und tanzte erst einmal wie ein Derwisch am Ufer umher, um meine erstarrten Gliedmaßen wieder aufzutauen. Ein Feuer anzumachen, wagte ich nicht, da der Rauch meine Position hätte verraten können. Ich schlüpfte also schnell in meine Sachen, hängte mir mein Gepäck um und lief nun am nördlichen Ufer des Wasserlaufes wieder in Richtung Brücke, um Kontakt mit der Straße zu bekommen. Um die Brücke selbst schlug ich einen gehörigen Bogem und erreichte die Straße in nicht allzu langer Zeit. Da ich es nicht wagte, sie offen zu benutzen – das erschien mir bei Tage zu gefährlich – arbeitete ich mich dicht neben ihr nach Norden voran. Das war ein mühseliges Unterfangen; zum Teil mußte ich mir den Weg mit meiner Axt bahnen. Es gab aber auch Abschnitte, wo das Vorankommen einfacher war; die dienten mir dann als willkommene Erholungsphase. Langsam wurde mir klar, daß ich mein ursprüngliches Vorhaben, bei Nacht zu marschieren und tagsüber in einem Versteck zu schlafen, nicht wahrmachen konnte, denn es war unmöglich sich nachts ohne Taschenlampe den Weg durch den Busch zu bahnen. Mittags machte ich eine Rast um mich erst einmal zu stärken und einen kleinen Mittagsschlaf einzulegen. Zu diesem Zweck entfernte ich mich von der Straße um vor Überraschungen sicher zu sein. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, daß die Kanadier auch nur einen Schritt in den Busch tun würden, um mich zu suchen. Als Eingeborene wußten sie viel zu gut, daß man eher die bewußte Stecknadel im Heuhaufen finden würde, als einen entflohenen Gefangenen im kanadischen Busch. Mir war klar, daß sie da auf mich lauerten, wo ich aus dem Busch heraustreten mußte, um wieder mit der Zivilisation in Berührung zu kommen. Gerade hatte ich mich zum Mittagsmahl niedergelassen, als ich durch lautes Rascheln aufgeschreckt wurde. Ich sprang auf und verjagte dabei zwei Racoons (Waschbären), die ich offenbar in ihrer Mittagsruhe gestört hatte. Sie jagten mir keinen Schrecken ein, wir waren den putzigen Gesellen schon des Öfteren bei der Arbeit im Busch begegnet und taten keinem Menschen etwas zuleide. Dann nickte ich ein und wachte erst nach einigen Stunden wieder auf, so daß ich an meinem ersten Tag in der Freiheit viel Zeit verloren hatte. Aber der Körper verlangte einfach nach Schlaf, und ich hatte ja auch keine Verabredung mit irgendjemandem in North Bay. So schlich ich mich also wieder in die Nähe der Straße und weiter ging es nach Norden. Bis zum Eintreten der Abenddämmerung schaffte ich noch eine ganz schöne Strecke und suchte mir als Nachtquatier eine geeignete Stelle in der Nähe der Straße. Auf einen Hochstand verzichtete ich diesmal, weil mir inzwischen klar geworden war, daß Bären klettern können. Nachdem ich meine Abendration verzehrt hatte, schlief ich auch bald ein. Es war aber ein unruhiger Schlaf, die Sinne waren zu angespannt. Oft fuhr ich hoch, wenn in der Nähe ein Zweig unter den Füßen eines Tieres knackte und so erwachte ich auch in der zweiten Nacht in Freiheit ziemlich verkatert und nahm mir vor, auch an diesem Tag die Mittagspause mit einem Mittagsschlaf zu verbinden, wenn es die Lage erlaubte. Angelehnt an meine Richtungsweiser – die schon oft erwähnte Straße Camp 33 – Petawawa – machte ich mich wieder auf den Weg zur Eisenbahnlinie Ottawa – North Bay, auf die ich noch an diesem Tag zu stoßen hoffte. Die Nähe des Truppenübungsplatzes Petawawa machte sich bereits bemerkbar: Deutlich konnte ich Geschützfeuer hören. Es war anscheinend ein Schießtag für die Artillerie auf dem Übungsplatz. Mir war nicht sehr wohl bei dem Gedanken, beim überqueren des Platzes aus Versehen in die „Impact Area“ (Zielgebiet) der Artellerie zu geraten. Über die Lage des Übungsplatzes hatten wir trotz allen Bemühens nichts Konkretes herausfinden können, und so war ich auf Vermutungen angewiesen und mußte mich möglichst nahe an die Feuerstellungen der Artellerie heranpirschen, um ihren Geschossen zu entgehen. Aber so weit war es noch nicht. Der kanadische Urwald schien kein Ende zu nehemen. Nach der Mittagspause verzichtete ich auf den vorgesehenen Schlaf. Ich war zu unruhig, meine Nerven zu angespannt, denn nach meinen Berechnungen mußte ich in der nächsten Stunde das Ende der Wildnis erreichen und in freieres Gelände kommen. Das war tatsächlich der Fall. Der Übergang vollzog sich nicht abrupt, sondern allmählich. Der Wald wurde zunehmend lichter und ich konnte mein Marschtempo erhöhen, obwohl ich jetzt vorsichtiger sein mußte. Es war durchaus möglich, daß Militärstreifen am Waldrand patroullierten. Endlich lag ein verhältnismäßig offenes Gelände vor mir, das aber nicht vollkommen deckungslos war. Kleinere Waldstücke und einzelne Buschgruppen boten sich als Zwischenziele an. Der Gefechtslärm, dem ich durch einen Bogen nach Osten so weit wie möglich ausgewichen war, verstummte, ich nahm an, daß die Artillerie ihr Pensum für den Tag erfüllt hatte. Während einer Pause in einem kleinen Waldstück hörte ich plötzlich ein Geräusch, das mir wie eine Engelsschalmei im Paradies vorkam: die Sirene eines Eisenbahnzuges, der in nicht allzu großer Entfernung von mir sein Kommen ankündigte. So konnte die Eisenbahnlinie nicht mehr weit von meinem Standort sein, und ich pirschte weiter in die Richtung, in der ich ihren Verlauf vermutete. Dann, nach dem Durchqueren eines Waldstücks, lag sie plötzlich vor mir. Das Gefühl, daß mich bei ihrem Anblick überkam, ist nicht zu beschreiben. Ich hatte mein erstes gestecktes Ziel erreicht und von nun an würde ich nicht mehr zu Fuß gehen, sondern bequem in einem kanadischen Güterwaggon nach North Bay fahren. Aber vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Erst einmal mußte es mir gelingen, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, ohne dem Zugpersonal aufzufallen. Und auch meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt: Es kam und kam kein Zug. Dann endlich kam einer, nur in der falschen Richtung, das heißt gen Ottawa. Langsam war aber dieser Zug nicht und es kamen mir erste Bedenken ob es mir bei der Geschwindigkeit überhaupt möglich sein würde, aufzuspringen. Bei Jack Londons „Abenteuer des Schienenstrangs“ hatte das immer so einfach geklungen. Dann näherte sich ein Zug, der in meine Richtung fuhr. Ich machte mich bereit, entledigte mich meiner Axt und hängte mir den Verpflegungsbeutel um. Ich ließ die Lokomotive vorbei und auch die ersten Waggons. Dann sprang ich hoch, rannte an dem Bahndamm und versuchte mein Glück. Vergeblich. Der verdammte Zug war einfach zu schnell und ich hätte mir sicher das Gnick gebrochen bei dem Versuch, aufzuspringen. Tief deprimiert sah ich den Zug in der Ferne verschwinden und suchte wieder meine Deckung. Es war mir klar, daß ich an dieser Stelle keinen Zug besteigen konnte, und ich beschloß, es an einer anderen zu versuchen, wo die Züge entweder noch nicht ihre volle Geschwindigkeit erreicht oder sie verringert hatten. Am günstigsten erschien mir die Nähe eines Bahnhofs. Ich war mir auch bewußt, daß ich mich dabei einer größeren Gefahr aussetzte, entdeckt zu werden. Sollte ich nun den Abend abwarten oder versuchen, mich bei Tage so nahe wie möglich an einen Bahnhof heranzupirschen? Ich entschloß mich für das letztere – ein entscheidender Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. Vorsichtig arbeitete ich mich zunächst von Deckung zu Deckung voran. Das wurde mir aber bald zu langweilig und ich wurde leichtsinnig. Beim Verlassen einer Buschgruppe hatte ich vorher nicht die Lage gepeilt und rannte prompt einer Rotte Eisenbahnarbeiter in die Arme, die am Bahndamm eine Pause eingelegt hatte. Um nicht Verdacht zu erregen, ging ich ganz unbefangen auf sie zu und nach dem üblichen beiderseitigen „Hi“ fragten sie mich, wo ich herkäme und wohin ich wollte. Ich sagte, daß ich aus einem Holzfällercamp bei Alice käme und in ein anderes bei Deep River wollte weil ich Ärger mit meinem Boß gehabt hatte. Bis Deep River seien es noch gut 15 Meilen, gaben sie mir zu verstehen und wollten wissen, weshalb ich nicht in Petawawa den Zug genommen hätte. Da ich keine Antwort parat hatte und glaubte, daß sie misstrauisch geworden waren, entschied ich mich, mein Heil in der Flucht zu suchen. Ich rannte, was das Zeug hielt, davon und tauchte in einem größeren Waldstück unter. Es war mir niemand gefolgt und ich wähnte mich schon in Sicherheit. Eine halbe Stunde später wurde ich eines Besseren belehrt. Eine Sirene ertönte, vermutlich im Militärlager Petawawa, und wenig später sah ich aus meiner Deckung in einem kleinen Waldstück, daß sich eine große Anzahl von Soldaten in Schützenkette meinem Versteck näherte. Ich verkroch mich zunächst hinter einem umgefallenen Baum und hörte wie sich die Treiber auf mich zu bewegten. Am Brechen von Zweigen erkannte ich, daß sie rechts und links an meinem Versteck vorbeiliefen ohne mich zu entdecken. Da machte ich meinen zweiten Fehler. Ich erhob mich, um mich auf die andere Seite des umgestürzten Baumes zu werfen. Ich war jedoch kaum auf der anderen Seite gelandet, als mich der Ruf: „Take them up, Buddy! I got you!“ zur Salzsäule erstarren ließ. Keine zehn Meter von mir entfernt stand ein Bulle von einem Kerl in kanadischer Uniform und fuchtelte mit einem Colt herum, der das Kaliber einer Zimmerflak zu haben schien. Zögernd hob ich die Hände hoch und da er zur gleichen Zeit seine Waffe auf mich richtete, glaubte ich, daß mein letztes Stündlein gekommen sei. Sein Colt ging aber weiter in die Höhe und dann schoß der Kanadier, der dem Canadian Provost Corps (Militärpolizei) angehörte, ein paarmal in die Luft, um seine Kameraden auf sich aufmerksam zu machen. Im Nu hatte sich ein gutes Dutzend Provosts um uns versammelt. Einer legte mir sicherheitshalber Handschellen an, ein Anderer steckte mir einen Glimmstengel in den Mund und dann gruppierten wir uns alle für ein Foto. Die Kanadier waren vor Freude über ihren Erfolg, übermütig wie die Kinder und hofften, daß sie als Belohnung für mein Ergreifen einen Tag Sonderurlaub bekommen würden. Sie brachten mich zu einem Jeep und nach kurzer Fahrt landeten wir im Lager des Truppenübungsplatzes Petawawa. Erst jetzt wurde mir bewußt, daß das Abenteuer Flucht beendet war. Zu kurz war der Ausflug in die Freiheit gewesen. Die lange Vorbereitung, das aufs Spiel setzen meiner Gesundheit wohlmöglich auch meines Lebens war völlig umsonst gewesen. Mein törichtes Verhalten beim Treffen auf die Eisenbahnarbeiter hatte alles verdorben. Wut über mich selbst und Enttäuschung wurden von Gedanken abgelöst, die ich erst nicht wahrhaben wollte: Sei froh, daß alles vorbei und glimpflich abgegangen ist. Allein wärst du über kurz oder lang vor die Hunde gegangen. Die ganze Flucht war bereits zum Scheitern verurteilt, als sie Hannes schnappten. Zu zweit hätten wir eine Chance gehabt, allein nicht. Dann begann ein Verhör, bei dem meine Identität festgestellt wurde. Leugnen hatte wenig Zweck, ich gab zu, der entflohene POW aus Camp 33 zu sein. Sie riefen unser Lager an, damit man jemanden schickte, um mich abzuholen. Inzwischen erhielt ich einen Becher mit heißem Tee und freundliche Worte, die mich in ein Gespräch ziehen sollten. Die Runde wurde jedoch jäh durch einen hereinstürmenden Army Captain unterbrochen, der mich mit hochrotem Gesicht anschrie, daß die verdammten Deutschen 42 kanadische Offiziere, die aus dem deutschen Kriegsgefangenenlager entflohen waren, bei ihrem Wiederergreifen erschossen hätten. Ich könnte mich glücklich schätzen, daß er mich nicht auf der Flucht erwischt habe,denn dann wäre ich jetzt eine Leiche. Die Kanadier sahen ihren Captain verstört an und mir wurde sehr mulmig. Mit einem barschen Befehl löste er die Runde auf und ließ mich in eine Arrestzelle bringen. Ich war froh, als endlich zwei Soldaten aus unserem Camp eintrafen, um mich abzuholen. Ein Stein fiel mir vom Herzen, als sich unser Fahrzeug in Bewegung setzte und aus dem Einwirkungsbereich des zornigen Captains verschwand. „Don`t worry, you are safe now!“ gab mir einer der Veteran Guards zu verstehen, und ich fühlte mich tatsächlich wie wieder zuhause. Damals konnte ich mir einfach nicht vorstellen, daß deutsche Soldaten die kanadischen Offiziere auf der Flucht erschossen hatten. Was für erbärmliche Kreaturen – hilflose und unbewaffnete Flüchtlinge zu ermorden. Hoffentlich haben sie nach dem Krieg ihren verdienten Lohn erhalten.
So landeten wir wieder im Camp 33. Meine Ankunft verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und als ich an der Wache aus dem Fahrzeug stieg, drängten sich viele POWs zusammen und hießen mich mit lautem Gejohle willkommen. Ich wurde zunächst in das Wachlokal gebracht und musste mich splitternackt ausziehen, damit man in aller Ruhe meine Sachen filzen konnte. Inzwischen sperrte man mich in eine Arrestzelle und gab mir eine Wolldecke, um meine Blöße zu bedecken. Mir war das Wärmen wichtiger, da ich vor Kälte klapperte. Es dauerte jedoch nicht sehr lange, bis mir einer der Posten meine Sachen zurückbrachte. Ich zog mich an, und meine besondere Aufmerksamkeit galt meiner Turnhose, in der ich meine Dollarnoten versteckt hatte. Hannes und ich hatten unser Papiergeld auf ein Streichholz ausgerollt, dann das Hölzchen herausgezogen und den gerollten Schein in den Turnhosenbund geschoben, wo er – getarnt durch das Gummiband – ein sicheres Versteck fand. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, daß sich mein Kapital noch unversehrt im Versteck befand und mir somit weiter zur Verfügung stand. Bald darauf erschien ein Sergeant mit zwei bewaffneten Opas in meiner Zelle und teilte mir mit, daß ich nun dem deutschen Lagerkommandanten vorgeführt würde, um meine Strafe zu erhalten. Als er anfing, mir das ganze damit verbundene Zeremoniell zu erklären, unterbrach ich ihn mit dem Einwurf, daß der ganze Humbug für mich ein alter Hut sei, da die Kanadier im militärischen Bereich doch nur ihre Herren und Vettern, die Briten kopierten und ich das Ganze in England mehrmals durchexerziert hätte. Er nahm meine Erklärung mit einigem Erstaunen zur Kenntnis und dann wiederholte sich das, was ich in England geübt hatte. Wir stellten uns in Linie zu einem Glied auf, ich in der Mitte, und je ein Posten rechts und links von mir. Der Sergeant bellte seine Kommandos: „Attention, right turn. Quick march!“ und ab ging es in Richtung des kanadischen Kommandantenbüros. Dann standen wir vor ihm, einem netten alten Herrn, dessen Sohn in Italien in deutsche Kriegsgefangenschaft gekommen war und der in seinen Briefen nach Hause nur Gutes über seine Behandlung geschrieben hatte. Der Kommandant sah mich lächelnd an und sagte: „Well done. But I have to punish you for stealing and damaging Canadian property!”. Ich bekam die obligatorischen 28 Tage Arrest, aber ohne jede Verschärfung. Der Arrest für Kriegsgefangene wurde in einer eigens dafür gebauten Baracke vollzogen, die unmittelbar an das Lager grenzte und von diesem nur durch einen einfachen Zaun getrennt war. Dieser Umstand sollte mir noch zugutekommen. Da ich meinte, daß Hannes Schwede sich nur in der Arrestbaracke befinden könne, rief ich beim Betreten der Baracke sofort: „Hannes, bist du hier?“ Und er war da. Er wollte von mir natürlich sofort wissen, wie es mir ergangen sei, und ich gab ihm von meiner Zelle aus, die an die seine grenzte, einen ausführlichen Bericht. Er sagte, daß man mich nicht so schnell erwischt hätte, wenn wir zu zweit gewesen wären. Das war sicher richtig, aber ein schwacher Trost. Gleich nach dem Abendessen legte ich mich auf meine Pritsche, die mir nach den Nächten im Busch wie ein Himmelbett vorkam, und fiel in einen tiefen und langen Schlaf, aus dem mich am nächsten Morgen ein Posten riß um mich zur Morgentoilette abzuholen.
Und dann begann wieder die Eintönigkeit des Arrestes, nur unterbrochen durch einen zweimaligen täglichen Spaziergang rund um die Arrestbaracke. Durch die günstige Lage der Baracke zum Camp konnte ich während dieser Spaziergänge Verbindung mit meinen Lagerkameraden aufnehmen und sie über meine Flucht in Kenntnis setzen. Sie warfen mir auch Päckchen mit Zigaretten über den Zaun, damit ich etwas zu rauchen hatte, da ich ja offiziell kein Geld und auch kein Lagergeld hatte, um etwas zu kaufen. Die freundlichen alten Herren, die sich bei meiner Bewachung ablösten, gaben mir zu verstehen, daß die Spender der Zigaretten die Päckchen nicht ausgerechnet den Posten vor die Füße werfen sollten, denn dann müßten sie diese konfiszieren. Das war ein guter Rat, den ich meinen Kameraden übermittelte, und von da an wurden Zigaretten nur noch über den Zaun geworfen, wenn kein Posten in der Nähe war oder uns den Rücken zukehrte. Es gab aber bei der Wachmannschaft einen besonders eifrigen Unteroffizier, der im Gegensatz zur Mehrzahl des Wachpersonals streng auf die Durchführung der Vorschriften, der „Kings Regulations“, bestand. So wurde er eines Tages bei einer Inspektion der Baracke gewahr, daß ich mich laut und deutlich mit meinem Zellennachbarn, Hannes Schwede, unterhielt. Da wir die einzigen Insassen der Baracke waren, veranlaßte er, daß wir in Zellen verlegt wurden, die so weit wie nur irgend möglich voneinander entfernt lagen. Das war das Ende unserer Gespräche und trug dazu bei, daß wir die Monotonie der Einzelhaft noch stärker spürten. Wir bekamen zwar pro Woche zwei Bücher aus der deutschen Lagerbücherei, und ab und zu steckte uns einer der Posten eine Tageszeitung zu, dennoch war die Langeweile unser größtes Problem, denn vier Wochen können eine verdammt lange Zeit sein unter solchen Voraussetzungen. Es war inzwischen Anfang Mai 1945 geworden, und der Krieg näherte sich mit Riesenschritten seinem Ende. Schon vor unserer Flucht, praktisch seit dem Scheitern der Ardennenoffensive, hatte ja auch im Westen der Krieg deutschen Boden erreicht, und die Wehrmacht kämpfte einen aussichtslosen Kampf, den aber bisher niemand den Mut hatte zu beenden. Im Osten war jetzt auch meine Heimatstadt Zilenzig in der Neumark schon lange in russischer Hand. Sie war sogar in einem Auszug aus dem deutschen Wehrmachtsbericht erwähnt, der in einer kanadischen Zeitung erschien. Darin hieß es, daß heftige Kämpfe um „hedgehog positions“ (Igelstellungen) bei Zielenzig tobten. Im März erfuhr ich sogar durch einen Brief meiner Eltern, daß sie im Gegensatz zu vielen anderen Mitbewohnern in letzter Minute über die Oder den Russen entkommen waren, die die Stadt besetzten. Sie, meine beiden Schwestern und ein Enkelkind, waren praktisch vom letzten Wehrmachtsfahrzeug, das die Stadt verließ, mitgenommen worden. Der Teil der Bevölkerung, der die Stadt viel zu spät mit einem Treck verlassen hatte, wurde vor der Oder von den Russen eingeholt, zusammengeschossen und überrollt. Die Überlebenden wurden nach Zilenzig zurückgetrieben; die Männer, soweit man sie nicht gleich sofort an Ort und Stelle umgebracht hatte, nach Sibierien verschleppt. Viele von ihnen gingen schon auf dem Marsch dorthin elend zugrunde. Am schlimmsten erging es jedoch den Frauen und Mädchen, an denen die Rotarmisten ihre Rache für die Leiden ihres Landes vollzogen. Eine ganze Reihe der Mädchen, die ich gut gekannt hatte, wurden nach widerholten Vergewaltigungen dann ebenfalls nach Osten verschleppt und nur einige kehrten zurück. Deutschland wurde jetzt doppelt und dreifach zurückgezahlt, was die Deutschen anderen Völkern angetan hatten. In dem Brief meiner Eltern vom März glaubten diese immer noch nicht, daß der Krieg endgültig verloren sei. Mein Vater schrieb sinngemäß, daß sie nun bei Frankfurt/Oder säßen und darauf warteten, daß eine deutsche Gegenoffensive die Russen wieder von deutschem Boden vertreiben würde und daß sie dann in die Heimat zurückkehren könnten. Diese Bewußtseinslage scheint heute unvorstellbar angesichts der damaligen militärischen Situation; die Meinung meiner Eltern wurde aber von vielen anderen geteilt. Die ständige Gehirnwäsche hatte aus vielen Landsleuten eine kritikunfähige Menge gemacht, der auch die Begriffe Recht und Gerechtigkeit abhandengekommen waren. Aber zurück nach Kanada in den ersten Maitagen 1945. Eines Morgens, es muß wohl der achte Mai gewesen sein, erhob sich bei den Kanadiern ein großes Geschrei, ich hörte das Abfeuern von Schüssen und das Heulen der Lagersirene. Ein Posten kam in meine Zelle gestürzt und rief mir freudestrahlend zu: „Son, the bloody war is over, you will be going home soon!“ Ich war zunächst wie vom Schlag gerührt; nun war das eingetreten, was wir bis zuletzt nicht hatten glauben wollen: Deutschland hatte den Krieg verloren und war auf die Gnade der Sieger angewiesen. An eine baldige Heimkehr glaubten wir Gefangenen alle nicht und sollten damit Recht behalten. Für die meisten von uns gingen noch weitere zwei Jahre ins Land, ehe wir wieder deutschen Boden betraten. Durch mein Zellenfenster konnte ich wahrnehmen, daß die Wachen verstärkt und am Apellplatz Maschinengewehre in Stellung gebracht wurden. Die Kriegsgefangenen wurden über den Lagerlautsprecher aufgefordert, zu einem Sonderappell anzutreten. Das Lager trat wie bei den Zählungen Barackenweise auf den Appellplatz an und wurde von dem deutschen Lagerführer den Kanadiern gemeldet. Dann verlas der kanadische Lagerkommandant eine Erklärung, die von dem Lagerdolmetscher übersetzt wurde. Was dem Lager im Einzelnen mitgeteilt wurde, konnte ich nicht verstehen, aber was konnte es anders sein, als die Mitteilung vom Ende des Krieges.
Dann ereignete sich etwas, was die Kanadier sicher nicht erwartet hatten: Der deutsche Lagerführer ließ das Lager stillstehen und dann erklang das Deutschlandlied. Das Horst-Wessel-Lied ließ man weg. Danach ließ der Lagerführer wegtreten, und die Gefangenen begaben sich ruhig in ihre Baracken, Freudenschreie gab es nicht. Ich hatte gehofft, daß man Hannes und mich amnestieren und unseren Arrest beenden würde, aber da lag ich schief. Bis zur letzten Minute saßen wir unsere 28 Tage ab und fanden bei unserer Entlassung ins Lager seine Insassen in einer anderen Verfassung vor als vor der Flucht. Eine ganze Anzahl hatte schon die Dienstgradabzeichen abgelegt und fühlte sich nicht mehr als Soldat, obwohl sich auf ausdrücklichen Befehl der Kanadier nichts an der soldatischen Rangordnung änderte. Es erschien mir zunächst auch unbegreiflich, daß mein Bridgelehrer, Pfarrer F. bei dem ich mich nach meiner Entlassung aus dem Arrest zurückmeldete, nun auch andere Töne anschlug. Es sei ein Segen, daß die nationalsozialistische Pest endlich ein Ende gefunden habe. Wie Recht er hatte, nur war ich damals noch nicht in der Lage, das einzusehen. Ich drehte mich also auf dem Absatz um und verließ ihn, um ihm erst Jahre später in Deutschland wiederzubegegnen und mich für mein Verhalten zu entschuldigen. Im Augenblick war er für mich so gut wie gestorben; Ich war nicht in der Lage, die wirklichen Zusammenhänge zu erkennen; das bedurfte noch eines langen Lernprozesses. Ein paar Tage später wurden 50 Mann aller Dienstgrade, die irgendwann einmal als Troublemakers in Erscheinung getreten waren, vor die kanadische Lagerführung zitiert. Man teilte uns die Verlegung in ein anderes Lager mit, da wir ein Hemmschuh für die demokratische Umerziehung der anderen Lagerinsassen seien.
Na ja, Sonntagsschüler waren wir auch nicht, die da versammelt waren. Alle, die einmal ausgebrochen oder renitent gegenüber den Kanadiern gewesen waren und von denen man glaubte, daß sie großen Einfluß auf die Haltung des Lagers ausüben könnten waren dabei. An sich hatten wir nichts gegen einen Tapetenwechsel, brachte die Verlegung doch Abwechslung in unser eintöniges Dasein. Zudem war Petawawa nicht gerade der letzte Schrei. Die Wildnis, in der wir hausten, konnte einem ganz schön auf den Wecker fallen. Wir packten also unsere Seesäcke bzw. Holzkoffer, nahmen Abschied von den anderen und fanden uns zur befohlenen Zeit am Lagertor ein. Dann fuhren wir mit LKWs zum Bahnhof Petawawa und bestiegen einen Zug mit unbekanntem Ziel irgendwo im Westen Kanadas. Es wurde uns aber bedeutet, daß wir eine lange Reise vor uns hätten. Im Gegensatz zu früheren Verlegungen mit der Bahn in Zügen, die ausschließlich mit Gefangenen besetzt waren, war diesmal nur ein Waggon mit uns 50 POWs an einen normal verkehrenden Personenzug angehängt. Das hatte zur Folge, daß wir auf viel mehr Bahnhöfen anhielten, uns öfter die Füße vertreten konnten und mehr von den Städten und Ortschaften Kanadas sahen. Bis Mattawawa folgten wir im Ottawa Valley dem Ottawa River, dann ging es weiter nach Norden über Cochrane, Kapuskasing, Hearst, durch hunderte von Meilen unberührter Wildnis an der Nordspitze des Lake Nipigon vorbei nach Sioux Lookout. Bis hierher hatten wir schon gut 100 Meilen zurückgelegt.
Was war das nur für ein Land! Wieder hatte ich den Eindruck, daß es nur aus Seen, Flüßen und Wäldern bestand. Die Gegend um den Centre Lake bei Petawawa, aus der wir gekommen waren, erschien uns im Vergleich zu der jungfräulichen Wildnis, die wir nun zu durchfahren hatten, als Perle der Zivilistation. Menschen waren hier im Norden offenbar noch Mangelware. Aber Kanada hatte ja auch Mitte der 40er Jahre nur etwa 11 Millionen Einwohner und die verloren sich in der ungeheuren Weite eines Landes, das über zwanzigmal so groß wie Westdeutschland ist. Auch heute bietet Kanada trotz der Verdopplung seiner Bevölkerungszahl noch Raum für viele Millionen Menschen; aber die Kanadier forcierten mit gutem Grund die Besiedelung ihres Landes nicht. Sie können wählerisch sein bei denjenigen, die einwandern wollen, und sie sind es auch. Qualität geht ihnen vor Quantität; sie hoffen auf diesem Wege künftige soziale Probleme auszuschließen.
Weitere 150 Meilen hatten wir bis Kenora zurückzulegen und passierten dann bei Ingolf die Provinzgrenze zwischen Ontario und Manitoba, der ersten Prärieprovinz. Das Bild der Landschaft wandelte sich vollkommen. Anstelle der endlosen Wälder waren es nun endlos erscheinende Felder, gekennzeichnet durch hohe Getreidesilos. In Winnipeg, der Hauptstadt Manitobas, hatten wir einen längeren Aufenthalt und gewannen so einen Eindruck von der Stadt. Sie kam uns vor wie eine der Western-Towns in einem Cowboy-Film. Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir die vielen hölzernen Leitungsmasten mit ihren Strom- und Telefonkabeln. Sie überzogen die Stadt wie ein Spinnennetz. 22 Jahre später kam ich noch einmal nach Winnipeg und erkannte es nicht wieder. Aus dem verschlafenen Provinzstädtchen war eine moderne Metropole geworden, mit allem was dazu gehört. Ehrlich gesagt, in ihrem alten Zustand hatte mir die Stadt besser gefallen, aber der sogenannte Fortschritt ließ sich nun einmal nicht aufhalten und die Menschen im heutigen Winnipeg würden angesichts des Angebots, zu den alten Verhältnissen zurückzukehren sicher „nein danke“ sagen. So durchquerten wir Meile auf Meile auch diese Provinz und landeten schließlich in der zweiten Prärieprovinz Saskatchewan. Auch hier das gleiche Bild: endlose Strecken besten Ackerbodens. Unsere Reise schien kein Ende zu nehmen. Unser Verhältnis zu den Bewachern war inzwischen ausgezeichnet, nachdem sie sich selbst davon überzeugt hatten, daß es sich bei den „50 Schwerverbrechern“ um nichts weiter als eine Bande wilder, dummer Jungen handelte, die nicht viel anders als ihre eigenen Söhne waren. Auf unsere wiederholten Fragen hatten sie uns schließlich gesagt, daß unsere Reise noch eine Weile dauern würde, und daß unser Zielort das große Gefangenenlager 133 bei Lethridge in Alberta sei. Da auch die längste Reise einmal ein Ende findet, gelangten wir schließlich dorthin. Das Lager bot von außen einen trostlosen Anblick. Man hatte es anscheinend „in the middle of nowhere“, auf ein Stück unfruchtbaren Landes einfach in die Geographie gesetzt. Es sah riesig aus. Doppelstöckige Baracken, die man kaum zählen und ein Zaun, dessen Ende man nicht sehen konnte. In einer Baracke vor dem Tor, in der wir registriert wurden, machte uns der deutsche Lagerführer, ein Oberfeldwebel, seine Aufwartung und hieß uns willkommen. Er trug wie wir nach wie vor seine militärischen Auszeichnungen und begrüßte uns mit dem sogenannten „Deutschen Gruß“. Hier in Lethridge schien die Zeit stehengeblieben zu sein; hier gab es keine Veränderung wie in Petawawa. Wie uns der Lagerführer erklärte, bestand das Lager aus alten und uralten POWs. d.h. hier war alles versammelt, was in der Zeit vor Kriegsbeginn bis zur Kapitulation des Afrikakorps in Gefangenschaft geraten war. Hier hatte sich alles versammelt, was der Wehrmacht die Erfolge der ersten Kriegsjahre beschert hatte, die Creme de la Creme aller drei Wehrmachtsteile. Die U-Bootfahrer erfolgreicher Boote, die Veteranen der „Battle of Britain“ und Rommels Wüstenfüchse. Viele hatten schon vier und fünf Jahre Gefangenschaft hinter sich und wollten nicht warhaben, daß der Krieg verloren war. Mancher glaubte allen Ernstes, daß sich Teile der deutschen Wehrmacht in die Alpenfeste zurückgezogen hätten, und daß von dort mit neuen Wunderwaffen eine Wende des Krieges eingeleitet werden würde. Nachdem der Bürokratie Genüge getan war, betraten wir das Lager und wurden von den Barackenältesten der Häuser, die uns aufnehmen sollten, in Empfang genommen. Zusammen mit anderen Feldwebeldienst- graden bezog ich eine Stube im oberen Stockwerk einer Baracke. An und für sich bestand jede Stube einer Baracke aus einem einzigen großen Raum. Die findigen POWs hatten jedoch mit Hilfe von Holzspinden den riesigen Raum in Stuben für je 12 Mann unterteilt und damit eine gewisse Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre erzeugt. Es war kein Problem, mit den neuen Stubengenossen auszukommen. Wir sprachen die gleiche Sprache, gehörten der gleichen Zunft an. Man gab sich große Mühe, uns in die Wohngemeinschaft aufzunehmen, obwohl sie statt mit neun nun mit zwölf Mann den nicht allzu üppig bemessenen Raum teilen mußten. Sie gingen auch mit uns durch die anderen Stuben unseres Stockwerks und machten uns mit den anderen bekannt. Diese Visite blieb jedoch auf unseren oberen Stock beschränkt; die im Unterhaus wurden ausgespart, sie wohnten quasi in einer anderen Straße und gehörten nicht zur Nachbarschaft. Natürlich lernten wir auch andere POWs des Lagers kennen, das blieb nicht aus. Da fanden sich Leute aus der gleichen Flottille, dem gleichen Geschwader, der gleichen Kompanie. Mit dem einen war man auf einem Lehrgang zusammen gewesen, dem anderen in einer Kneipe begegnet. Beim Gang durch unser Stockwerk erwartete mich eine Überraschung. Ich traf Lothar Bartsch vom Gutlinaberg bei Drossen, der mit mir zusammen im Internat in Drossen gewesen war. Er war damals zwar einige Klassen über mir gewesen und machte bald nach meinem Eintreffen in Drossen Abitur, aber er war mir noch als ausgezeichneter Sportler in Erinnerung. Lothar war schon sehr früh als Pilot über England abgeschossen worden und als Oberfähnrich schließlich auch in einem Mannschaftslager gelandet. Die Widersehensfreude war groß, und es gab viel von der alten Penne zu berichten. Mit ihm zusammen auf der Stube war auch Herbert Widmeyer, ebenfalls Luftwaffenpilot, der sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland einen Namen als Fußballspieler und -trainer machen sollte. Da sie beide lange Kerls von gut über eins achtzig waren, verpassten sie mir den Spitznamen „Shorty“, der mir gar nicht passte, war ich doch mit meinen eins dreiundsiebzig immerhin gut über das damalige Mittelmaß hinaus. Es dauerte eine Weile, bis wir uns in der neuen Umgebung zurechtfanden. Im Gegensatz zu Petawawa war hier alles riesig. Über 10.000 Gefangene, eine mittlere Kleinstadt, eine Stadt ohne Frauen aber voller Hunde. Das war uns Neuankömmlingen als erstes aufgefallen; es gab hier im Lager eine große Anzahl von Vierbeinern aller Rassen und Mischungen. Die großzügigen Kanadier hatten den POWs erlaubt, Hunde im Lager zu halten. Daß die meisten dieser Hunde einem traurigen Schicksal entgegen gingen, ahnte zu der Zeit noch niemand. Es dauerte Tage, bis wir das Lager erkundet hatten, und es konnte einem manchmal vorkommen, als befänden wir uns in einem gewaltigen Trainingslager für Sportler, denn es gab Sportanlagen in Hülle und Fülle. Da waren sechs gut angelegte, den internationalen Abmessungen entsprechende Fußballplätze, fast zwei Dutzend Faustballplätze, drei große Sporthallen und vieles andere mehr. Es gab regelmäßige Filmvorführungen und eine Bücherei, die jeder deutschen Stadt ähnlicher Größe alle Ehre gemacht hätte. Das Angebot an Kursen aller Wissenschaftsbereiche war enorm. Praktisch war jedes Wissensgebiet vertreten. Aber das Paradies hatte einen Schönheitsfehler: Es war ein Gefängnis, in dem Männer wie Mönche in einem Kloster leben mußten. Gesunde junge Männer, die aufgrund der guten Verpflegung nicht wußten, wo sie ihre überschüssige Kraft lassen sollten. In der geringen Zahl von Arbeitskommandos, die draußen auf den umliegenden Farmen eingesetzt wurden, drängten sich jedoch nicht viele nach der Landarbeit. Rüben hacken und verziehen und die Rübenernte im Herbst waren ziemlich geisttötende Arbeiten. In dieser Gegend schien man sich auf den Anbau von Zuckerrüben spezalisiert zu haben; die Farmer waren in der Mehrzahl ukrainischer Herkunft und sehr umgänglich. Es sollte aber die Zeit kommen, in der sich die POWs nach dieser Arbeit oder jeder anderen Außenarbeit rissen. Das Verhängnis nahte nämlich in Gestalt eines Wing-Commanders (Luftwaffen-Oberstleutnant) der RCAF (Royal Canadian Air-Force), dessen Vorfahren in der alten Donaumonarchie zuhause gewesen waren. Er sollte aus den verstockten Nazis und Militaristen nützliche Glieder der menschlichen Gesellschaft machen; die Periode der „Reeducation“ begann. Abteilungsweise hatten wir uns im Kinosaal zu versammeln und wurden durch den „Kameraden Schnürschuh“, wie wir den Wing-Commander tauften, mit dem bekanntgemacht, was uns erwartete. Zunächst wurden uns Filme über die bestialischen Zustände in den von Allierten befreiten deutschen Konzentrationslagern vorgeführt. Die Reaktion darauf war unterschiedlich. Ehrliche Betroffenheit und Nachdenklichkeit spiegelte sich in vielen Gesichtern. Es erhob sich aber auch ein wüstes Geschrei: „Lüge, Propaganda, das ist der Bromberger Blutsonntag, hier hat man die Opfer der Terrorangriffe zusammengekarrt!“ Einige wollten sich auf den Wing-Commander stürzen, wichen aber vor den Gewehren seiner Begleitmannschaft zurück. Ohne auf dessen Befehle zu achten, verließen die Gefangenen wütend den Saal. Es folgte dann als nächster Schritt eine Fragebogenaktion, die den Kanadiern Aufschluß über unsere Gesinnung geben sollte. Da gab es Fragen wie: „Was glauben Sie, wieviele Juden in den deutschen Konzentrationslagern umgebracht wurden?“ „Wer war der größte Deutsche?“ „Was ist Ihr politisches Bekenntnis?“ Die Antworten waren zum Teil erschütternd. Die erste Frage hatten viele mit „viel zu wenige“; die zweite mit „Hitler“ beantwortet und zur dritten äußerten sich nicht wenige nach Absprache mit anderen wie folgt: „Ich war ein Nationalsozialist, ich bin ein Nationalsozialist und ich werde ein Nationalsozialist bleiben!“ Diese Kameraden fanden auf ihren Fragebögen nach deren Rückgabe an die Betroffenen den Vermerk: „Sie waren ein Kriegsgefangener, Sie sind ein Kriegsgefangener und Sie werden ein Kriegsgefangener bleiben!“ Im Großen und Ganzen war die Fragebogenaktion jedoch ein Fehlschlag, denn die meisten von uns hatten den Fragebogen einfach in den Papierkorb geworfen. Wieder wurden wir in den Kinosaal zitiert, und der Wing-Commander, begleitet von einer starken Eskorte, die auch die Ausgänge abriegelte, gab uns in einer kurzen Rede zu verstehen, was er von uns hielt. Sinngemäß sagte er, daß wir eine Bande von unbelehrbaren Starrköpfen seien, die ihre Augen gegenüber den Tatsachen verschlössen. Er garantierte uns aber, daß er anständige Menschen auch gegen unseren Widerstand aus uns machen würde. Keiner von uns würde heimgeschickt werden, wenn er sein Verhalten nicht ändere. Wir seien von den Kanadiern bisher zu sehr verhätschelt worden, damit sei jetzt Schluß und wir würden einen Vorgeschmack von dem bekommen, was die Deutschen anderen angetan hätten. Keiner von uns würde jedoch sterben, aber wir sollten fühlen, wie es ist, Hunger zu haben. Die Rationen würden in einem Maße gekürzt werden, daß wir hungern würden, bis uns die Schwarte kracht. Umerziehung mit vollem Magen sei ein untauglicher Versuch, der mit sofortiger Wirkung aufgegeben würde. Wir johlten und lachten ihn aus. Das Lachen sollte uns aber bald vergehen. Die „schönen Tage von Aranjuez“ waren wirklich vorüber. Der Hunger begann in unseren Eingeweiden zu wühlen, und er bewirkte es auch, daß die Solidarität der Kriegsgefangenen binnen kurzem vor die Hunde ging. Viele legten ihre Dienstgradsabzeichen und Auszeichnungen ab; die Österreicher entdeckten ihr nationales Herz und legten österreichische Kokarden an. Es bildeten sich demokratische Arbeitskreise, und viele Freundschaften gingen aufgrund gegensätzlicher Ansichten in die Brüche. Die Zahl der Hunde im Lager verringerte sich schlagartig. Sie wurden von ihren Herrchen verspeist. Arbeiten außerhalb des Lagers waren begehrt wie nie zuvor, da es sich herumgesprochen hatte, daß die Farmer den für sie arbeitenden Kriegsgefangenen gut und reichlich zu essen gaben, da sie sonst garnicht in der Lage gewesen wären, die schwere Arbeit der Rübenernte zu tun. Einmal hatte auch ich das Glück, einem Arbeitskommando zugeteilt zu werden. Ehe wir mit der Arbeit begannen, durften wir uns den Bauch mit Hühnerfleisch und Kartoffeln vollschlagen. Der Erfolg stellte sich dann auch postwendend ein. Nach unserer Rückkehr am Abend in das Lager kamen wir kaum noch aus den Toiletten heraus. Der Farmer hatte uns auch noch Verpflegung mitgegeben, Getreide und Brot. Das alles wurde uns jedoch bei der Filzung vor dem Betreten des Lagers abgenommen und in unserer Anwesenheit verbrannt. Wir schäumten innerlich vor Wut, aber die Hungerkur zeigte auch hier schon ihre Wirkung. Niemand protestierte laut gegen diese gemeine Maßnahme. Vor ein paar Wochen hätten wir noch ganz anders reagiert. Eine weitere Fragebogenaktion bewies dann auch, daß die Kanadier ihrem Ziel, die Böcke von den Schafen zu trennen, nähergekommen waren. Mit Entzug der Rationen sollte jeder bestraft werden, der seinen Fragebogen nicht ausfüllte oder ihn vernichtete. Mit wenigen Ausnahmen wurde dem Rechnung getragen. Dann geschah Folgendes: Das ganze Lager wurde umgekrempelt und neue Abteilungen gebildet. In der Abteilung A landeten die Superdemokraten, in B die Demokraten, in C die weder noch, in D die Militaristen und in E die Nazis. So einfach machten es sich die Kanadier, und bei dieser Methode landete natürlich nicht jeder dort, wo er eigentlich hingehörte. Ich landete nicht bei den Nazis, sondern bei den Militaristen und befand mich da in nicht schlechter Gesellschaft. Voller Stolz oder Sturheit trugen wir unsere Rangabzeichen und Auszeichnungen weiter und wollten sie erst bei unserer Entlassung aus der Wehrmacht, die gar nicht mehr bestand, oder am Tage unserer Entlassung aus der Gefangenschaft ablegen. Da waren wir noch auf der gleichen Wellenlänge wie die Nazis in der Abteilung E. Das Lager war gespalten, das Hungern aber ging weiter. Alle Abteilungen erhielten fairerweise die gleichen Rationen. Der einzige Vorteil, den A und B hatten war die Tatsache, daß aus ihnen die Arbeitskommandos für die Farm gebildet wurden, und sie sich draußen sattessen konnten. Der Hunger hatte aber auch seine anderen Seiten. Er trennte nicht nur die Gefangenen, er bewirkte auch bei einigen das Gegenteil. Sie schlossen sich eher in einer Trotzhaltung zusammen. So war es auf unserer Stube Sitte, daß derjenige, der Geburtstag hatte, von allen anderen Stubenkameraden als Geschenk eine Scheibe Brot bekam und sich an diesem Tage einmal sattessen konnte. Kurz vor Weihnachten änderte sich die Situation. Die Einwohner von Lethbridge hatten wohl mitbekommen, was in unserem Lager vor sich ging. Viele waren damit nicht einverstanden und verglichen die Vorgänge in unserem Lager zu Unrecht mit denen in deutschen Konzentrationslagern. Da sich auch die Presse dieser Angelegenheit annahm, hielt es die Lagerführung für angebracht, die Hungerkur oder „das große Fasten“, wie wir es nannten, zu beenden. Von einem Tag auf den anderen erhielten wir kurz vor Weihnachten wieder bessere Rationen, zwar nicht mehr die übertrieben großen aus der Zeit vor der „Reducation“, aber wir mußten nicht mehr Hunger leiden. So ging das Jahr 1945 zuende. Ich hatte inzwischen auch erfahren, daß meine Eltern und Schwestern den Krieg überlebt hatten. Die Eltern waren bei Verwandten bei Halle an der Saale untergekommen, und meine beiden Schwestern waren mit dem Kind der jüngeren Schwester bei einer Tante in Innsbruck auf der Hugenburg gelandet. Sie blieben dort, bis die Österreicher sie des Landes verwiesen. Alle warteten auf meine Entlassung, aber so weit war es noch lange nicht.
Anfang 1946 wurden dann die ersten Transporte zusammengestellt, und die „Evakuierung“ der deutschen Kriegsgefangenen aus Kanada begann. Keinen aus den anderen Abteilungen wunderte es, daß als erste die Abteilung der Superdemokraten die Reise nach Osten und über den großen Teich nach Europa antrat. Da die Kanadier eine Gewichtsgrenze für das mitzuführende Gepäck festgesetzt hatten, mußten die für die Transporte Auserwählten Abschied von so manchem nehmen, daß sich im Laufe der langen Jahre der Gefangenschaft angesammelt hatte. Eine gute Gelegenheit für die Zurückbleibenden, billig in den Besitz von Sachen zu gelangen, von denen sich die anderen trennen mußten. Wir nahmen alles, was wir nur bekommen konnten, dachten nicht daran, daß uns die gleiche Prozedur bevorstand, sollten wir einmal an die Reihe kommen und Kanada verlassen. Da wir aber zu den schwarzen Schafen gehörten, schien uns dieer Augenblick noch in weiter Ferne zu liegen, und getreu der alten Kriegsgefangenenweisheit, daß man alles gebrauchen kann, griffen wir zu. Was wir nicht verwenden konnten, ging in kanadische Hände über. Wir aus der Militaristen-Abteilung schworen uns aber, daß die Kanadier von uns nichts erben würden, sollten wir einmal Lethbridge Lebewohl sagen.
So verließen die Superdemokraten das Lager; keiner von ihnen trug mehr Dienstgradsabzeichen oder Auszeichnungen. Obwohl wir ein wenig neidisch auf die Heimkehrer waren, gab es keine bösen Worte, im Gegenteil, sie nahmen die Adressen von Angehörigen der Zurückbleibenden mit, Grüße und Briefe. Später sollten wir allerdings erfahren, daß ihre Reise in Frankreich endete, wo die meisten von ihnen in Bergwerken schwer arbeiten mußten. Im Laufe des ersten halben Jahres leerte sich das Lager immer mehr und, oh Wunder, eines Tages waren selbst wir Militaristen an der Reihe. Auch wir hatten die Gewichtsgrenze für das Gepäck einzuhalten; was wir mitnehmen durften, paßte bequem in einen Seesack. Wir trennten uns aber von dem Rest anders als unsere Vorgänger. Wir errichteten Scheiterhaufen und verbrannten unsere Schätze. Die Kanadier, die sich schon Hoffnung auf reiche Beute gemacht hatten, gingen leer aus. Nachdem man uns noch einmal gründlich gefilzt hatte, wobei mein Tagebuch beschlagnahmt wurde, bestiegen wir einen Zug, und die lange Fahrt quer durch Kanada begann, diesmal von West nach Ost. Namen von Städten und Eisenbahnstationen, die uns noch von der Reise nach Westen in Erinnerung waren, wurden in unser Gedächtnis zurückgerufen. Über Medicine Hat, Swift Current, Moose Jaw, Regina, Portaga la Pairie, Winnipeg ging es nach Kenora in der Provinz Ontario. Bis dahin hatten wir schon rund 1000 Meilen hinter uns gebracht. Weitere 2300 Meilen trennten uns noch von dem Ziel unserer Eisenbahnreise, Halifax in Nova Scotia, wo ich vor über zwei Jahren erstmals kanadischen Boden betreten hatte. Es dauerte aber noch Tage bis wir über Sioux Lookout, Mattawa, Ottawa, Quebec, Riviere du Loup, Moncton und Truro in Halifax ankamen.
Uns allen war die abweisende Haltung der kanadischen Zivilbevölkerung bei unseren Aufenthalten auf den Bahnhöfen aufgefallen. Kein Wunder, sie hatten in Erfahrung gebracht, welch unvorstellbare Greuel von Deutschen während des Krieges verübt worden waren. Sie waren von Deutschen und nicht nur „in deutschem Namen“, wie es heute unsere Politiker formulieren, begangen worden. Die betroffenen Völker werden das mit Recht nie vergessen. Keiner der Kanadier richtete ein Wort an uns; aus ihren Mienen sprach Verachtung. So verließen wir dieses großartige Land an Bord eines Veteranen unter den Truppentransportern, der „Mauretania“, mit einem Gefühl der Beklemmung und Scham. Wie schon auf der Fahrt von Glasgow nach Halifax war es auch diesmal keine Luxusreise. Wir waren in den großen Decks wie Heringe verpackt, sahen das Tageslicht aber im Unterschied zu unserer Reise nach Kanada zweimal täglich, und die Bewachung durch kanadische Soldaten schien einen rein formellen Charakter zu haben. Leider war das Wetter während der Überfahrt nach England schön, die See ruhig und die Zahl der Seekranken verhalf uns nicht zu einer nennenswerten Verbesserung der kargen Rationen. Ein Kumpel von mir, den wir wegen seiner roten Mähne den „roten Jim“nannten, Ex-U-Bootfahrer und Gefangener seit 1939, machte den Vorschlag, wir sollten uns um Arbeit in der Kombüse bewerben, um satt zu werden. Wir taten es und wurden zu unserer Überraschung auch für die Dauer von zwei Tagen für den Küchendienst eingeteilt.
Da man die Küchenhelfer nach der Devise „Man soll dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden“ behandelte, wurden wir endlich wieder einmal satt und konnten sogar noch Lebensmittel für unser Deck organisieren. Fairerweise hatte man uns noch in Lethbridge klargemacht; daß wir zwar Kanada verlassen aber nicht nach Deutschland gebracht würden. Wir sollten in England Wiederaufbauarbeit leisten. Unser Entlassungstermin stand noch in den Sternen.
Nach einer Seereise von knapp einer Woche liefen wir in den Hafen von Liverpool ein, wo ich 1943, von Afrika kommend, erstmals englischen Boden betreten hatte. Diesmal gab es aber keinen Kommandeur des Kommandos, der uns mit Reiseproviant versehen ließ. Unsere Bewachungsmannschaft wechselte. Von nun an waren wir bis zu unserem Eintreffen in einem Durchgangslager in Nottingham in der Obhut polnischer Soldaten der Anders-Armee. Sie behandelten uns verständlicherweise wie den letzten Dreck. Der Fußmarsch vom Bahnhof bei Nottingham bis zum Lager wird allen, die mitgemacht haben, in Erinnerung bleiben. Mit wüstem Geschrei und Knüppelschlägen trieb man uns vom Bahnhof zum Lager. Mancher von uns, der dem Eiltempo nicht folgen konnte, warf sein Gepäck fort, um den Knüppelhieben zu entgehen. Der Anblick unserer Uniformen mit Dienstgradsabzeichen und Orden hatte die Wut der Polen noch angestachelt, so sagte man uns später. Es ist aber auf diesem „Todesmarsch“, wie wir ihn nannten, keiner zu Tode gekommen, Beulen und blaue Flecken waren jedoch seine Erinnerungszeichen und vergingen bald. Unser Aufenthalt in diesem Lager war nur von kurzer Dauer. Erinnernswertes spielte sich kaum ab. Neu war für uns, die wir von den meisten der sich schon in diesem Lager Befindlichen als „Nazis aus Kanada“ bezeichnet wurden und daß es hier eine deutsche Lagerpolizei gab, für die wir ein rotes Tuch waren, da wir uns weigerten, unsere Dienstgradsabzeichen abzulegen. Es kam auch schon in der ersten Nacht nach unserer Ankunft zu ersten Auseinandersetzungen mit ihnen. Als sie widerholt unsere Baracke betraten, um uns zu kontrollieren und dabei frech und anmaßend auftraten, nahmen wir ihnen kurzerhand ihre Holzknüppel weg und vertrieben sie unsanft aus der Baracke. Sie ließen uns von da ab in Ruhe. Wir „Kanadier“ hielten wie Pech und Schwefel zusammen und bewirkten auch durch unseren Zusammenhalt, daß eine bis zu unserer Ankunft widerspruchslos hingenommene entwürdigende Maßnahme eines sich verrückt gebärdenden britischen Sergeants aufgehoben wurde. Dieser, zuständig für die Aufrechterhaltung der Disziplin, hatte jedem POW, der wegen irgendeines Vergehens in den Knast kam, eine Glatze schneiden lassen. Wir ließen ihm durch den deutschen Lagerführer ausrichten, daß wir nicht gewillt seien, dies hinzunehmen, und drohten, das Lager in Schutt und Asche zu legen, falls noch ein einziger POW kahlgeschoren würde. Es wurde niemand mehr kahlgeschoren. Unsere Anwesenheit bewirkte auch, daß eine ganze Reihe der Alteingessenen plötzlich wieder ihre abgelegten Dienstgradsabzeichen anlegten. Da beschloß die britische Lagerleitung uns Reaktionäre so schnell wie möglich loszuwerden. In Gruppen von 20 bis 30 wurden wir schleunigst in andere Lager verlegt und landeten mit rund zwei dutzend „Kanadiern“ im Camp 81 Brigg, Lincolnshire. Dieses Lager unterschied sich wohltuend von dem Nottingham. Die britische Lagerleitung war fair, die deutsche akzeptabel. Es gab auch keinen Doppelzaun mehr um das Lager; Stacheldrahtrollen markierten mehr symbolisch als effektiv die Lagergrenze und man erwartete von uns, daß wir diese respektierten. Wir taten dies zunächst auch, aber mit den steigenden Temperaturen des englischen Frühlings wurden auch wir unruhig und wollten feststellen, wie es jenseits der Stacheldrahtrollen aussah. Außerdem lief ein Gerücht im Lager um, daß es am anderen Ende von Brigg ein „Black House“ gäbe, in dem sich einige Damen des Gunstgewerbes einquartiert hätten, die nicht zwischen Briten und POWs unterschieden, solange der Tarif entrichtet wurde. Außer Zigaretten und unserer Jugend hatten wir nichts anzubieten, wollten jedoch auf jeden Fall feststellen, was an dem Gerücht wahr war. So schlichen wir eines nachts aus dem Lager, durchquerten in aller Ruhe das schlafende Brigg und fanden oder glaubten, das richtige „Black House“ gefunden zu haben.
Wir riskierten erst einmal einen Blick durch die Fenster und wahrhaftig, es befanden sich einige weibliche Geschöpfe in dem Haus, die auf unser Klopfen hin an die Fenster kamen und uns zu verstehen gaben, an der Tür zu läuten. Wir klingelten, und siehe da, die Tür wurde geöffnet – aber nicht so, wie wir es erwartet hatten. Statt der erhofften weiblichen Wesen erschien ein wutschnaubender Bulle von Kerl mit einem Knüppel, und machte Anstalten, sich auf uns zu stürzen. Wie die geölten Blitze ergriffen wir das Hasenpanier und legten zunächst einen gehörigen Sicherheitsabstand zwischen uns und dem Zerberus. Der folgte uns jedoch nicht, sondern beließ es bei Drohgebärden mit dem Knüppel und dem Rat, uns zur Hölle zu scheren. Da mußten wir wohl die falsche Adresse erwischt haben und waren sicher nicht die Ersten gewesen, die an seiner Tür geläutet hatten zum Ergötzen seiner sich im Haus befindlichen Töchter. Wir zogen also Leine, hatten aber keine Lust, sofort in das Lager zurückzukehren. So erkundeten wir in aller Ruhe eingehend die Hauptstraßen von Brigg und machten einen ausgedehnten Schaufensterbummel. Viel gab es da jedoch nicht zu sehen, denn auch die Briten lebten im Frühjahr 1946 nicht wie die Maden im Speck. Vor Morgengrauen waren wir dann wieder im Lager und banden unseren zurückgebliebenen Kameraden einen Bären auf über die Damen im „Black House“. Man glaubte unsere Spinnereien und einige beschlossen, gleich in der nächsten Nacht auch einen Liebestrip zu unternehmen. Der endete mit dem gleichen Resultat, was sie natürlich nicht zugaben.
Unser Aufenthalt in Brigg war auch nicht von großer Dauer. Mit einer Gruppe von ca. 20 POWs wurde ich in ein sogenanntes „Hostel“ verlegt, dass sich im Schloßpark von Einsham Hall befand. Fast jedes Kriegsgefangenenlager hatte als Ableger mehrere Hostels, die den Zweck hatten, die POWs näher an mögliche Arbeitsstellen und Massierungen von tausenden von Gefangenen an einer Stelle zu vermeiden. Außer uns in Eisham Hall gab es noch zwei weitere in unmittelbarer Nähe in Eisham Manor und Eisham Mount, deren Insassen wir des Öfteren besuchten. Eisham Hall selbst, ein mächtiger Herrensitz mit einem riesiegen Park, war unbewohnt und ein alter, einsamer Wildhüter, der in einem Nebengebäude des Schlosses einquartiert war, sorgte dafür, daß das Anwesen nicht verkam und von den POWs ausgeräumt wurde. Wir selber bezogen die uns schon so bekannten Nissenhütten, jämmerliche Wellblechbuden, die im Sommer zu heiß und im Winter nicht warm zu bekommen waren. An die 50 Mann bewohnten oder besser hausten darin in doppelstöckigen Pritschen. Außer Tischen und einem Stuhl für jeden gab es kein Mobiliar, keine Schränke zum Verstauen unserer Habe, sodaß unsere Seesäcke die Schränke ersetzen mußten. Bis zum Ende des Krieges hatten die Nissen-Hütten in Elsham Hall der Unterbringung von ATS-Girls, weiblichen Soldaten des Auxilitary Territorial Service gedient. Da wir nicht gleich Arbeitskommandos zugeteilt wurden, hatten wir Zeit und Muße die nähere Umgebung zu erkunden, um festzustellen wo wir Brauchbares organisieren konnten. Von besonderem Interesse waren natürlich Lebensmittel, da unsere Verpflegung nicht überwältigend war, und wir uns deshalb eifrig bemühten, sie legal oder illegal zu verbessern bzw. zu ergänzen. Zunächst sah es nicht vielversprechend aus. Kartoffeln und Rüben, mühsam aus Mieten herausgebuddelt; waren unsere einzige Beute. Dann aber lachte uns Fortuna. Bei einem Streifzug über die Wiesen und Felder der unmittelbaren Umgebung des Lagers entdeckten wir in den Knicks, die die Felder und Wiesen unterteilten, Kaninchenfallen und sagten uns, wo Fallen sind, muß es auch das eine oder andere dumme Kaninchen geben, das in eine der Fallen tappt. Und siehe da, unser Warten wurde belohnt. Mit drei Kaninchen traten wir den Heimweg an und hatten am gleichen Abend ein köstliches Mahl in der Sanitätsbaracke, wo es einen Spirituskocher zum Abkochen des Sanitätsmaterials und der Instrumente gab. Wir hatten diese Möglichkeit allerdings nur dem Umstand zu verdanken, daß wir gut mit dem leitenden Sani befreundet waren, der uns den Kocher benutzen ließ. Beziehungen sind eben auch in Gefangenschaft nicht zu unterschätzen. Selbstverständlich wurde der Sani eingeladen, an unserem Festschmaus teilzunehmen.
In den nächsten Tagen gab es noch öfter Kaninchenbraten, wenn wir auch die Kontrolle der Fallen auf die weitere Umgebung des Lagers ausdehnen mußten. Schlau, wie alte Gefangene nun einmal sind, achteten wir darauf, daß nicht sämtlihce Fallen geplündert wurden, um nicht den Argwohn der Fallenbesitzer – Farmer der Umgebung – zu wecken. Jeden Tag Rebhuhn, hat mal jemand richtig bemerkt, sei auch nicht der wahre Jakob und so sahen wir uns um, ob wir nicht noch Abwechslung in diesen Speiseplan bringen konnten. Nach Wild schien Fisch angemessen, und wo es Teich gab, sollte es auch Fische geben. Was lag näher, als den Schloßteich von Elsham Hall, der mitten in einem waldartigen Teil des Schloßparks lag, einer Inspektion zu unterziehen. Um festzustellen, ob es in dem Teich wirklich Fische gab, opferten wir einen Teil unserer Brotration. Wir warfen Brotstückchen in den Teich und siehe da, sie wurden Beute gieriger Fischmäuler. Nun galt es nur noch ein Problem zu lösen, nämlich an Angelhaken ranzukommen. Da aber ein POW-Camp von einigen hundert Mann über Talente in jedem Handwerkszweig verfügt, konnten wir jemand ausfindig machen, der uns für ein paar Zigaretten und einige Kaninchenkeulen Angelhaken fertigte. Die Beschaffung von Angelruten und Angelschnur war kein Problem, und so machten wir uns eines Abends auf, um unser Glück als Sportangler zu versuchen. Es dauerte zwar eine geraume Zeit, bis wir die erste Schleie an Land ziehen konnten, aber mit Geduld kam doch eine ganze Anzahl zusammen, die wir in Brotbeuteln verborgen ins Lager beförderten. So wurde das Kaninchenmahl von guten Fischmahlzeiten abgelöst.
Die Sache mit dem Abfischen des Schloßteichs blieb aber nicht lange ein Geheimnis und bald war ein mittelgroßer Angelverein bemüht, auch noch den letzten Fisch aus seinem Element zu holen. Jedoch wurden die Angler bald darauf aus ihrem Paradies vertrieben. Selbst dem alten Wildhüter des Schlosses konnte die Prozession zum Teich nicht verborgen bleiben, und so erschien er eines Abends mit seiner Schrotflinte bewaffnet am Teich und löste eine panikartige Flucht der Angler aus, als er einen Warnschuss – verbunden mit heftigen englischen Flüchen – abgab. Aus diesem Teich gab es fortan keinen Fisch mehr für uns, aber dem Wildhüter sollte sein Verhalten noch Leid tun. Wir beschlossen, dem gar nicht mal so unsympathischen Alten einen Streich zu spielen. Wir wußten nur noch nicht wie. Bald stellten wir aber fest, daß der Alte auch Fallen im Park stellte und jede Menge Kaninchen fing, die er zum größten Teil in der Umgebung verkaufte. Der Absatz war gut, da die Engländer – wie jedermann in Europa nach dem Krieg – bemüht waren, ihre kargen Rationen aufzubessern. Wir hatten bald heraus, wo er seine Fallen platzierte und so war es ein Leichtes, das eine oder andere Kaninchen zu entführen. Der große Clou kam jedoch noch. Einer von uns hatte die grandiose Idee, das mühselige Abklappern der Fallen aufzugeben, und dem Wildhüter seine ganze Beute abzujagen, wenn er diese vor dem Verkauf in einem alten Schuppen lagerte. So räumten wir ihm zu gegebener Zeit die gesamte Bude aus und hatten Kaninchen satt. Aber solch Coup war natürlich eine einmalige Angelegenheit und ließ sich nicht widerholen, denn nun wachte der Alte wie ein Schießhund darüber, daß ihm seine Beute nicht noch einmal vor dem Verkauf abhanden kam.
Eines Tages wurde unseren waidmännischen Exkursionen alles in allem ein Riegel vorgeschoben. Die englische Lagerleitung kam schließlich zu dem Schluß, daß es sinnlos und Verschwendung sei, deutsche Kriegsgefangene ohne Beschäftigung herumsitzen zu lassen, die nur nutzlose Esser waren und ohne geregelte Arbeit auf dumme Gedanken kamen. So wurden Arbeitskommandos zusammengestellt, die auf den verschiedensten Gebieten das ihre zur Wiedergutmachung beitragen sollten. Unser Hostel war dazu ausersehen, in der Landwirtschaft, in einer Zuckerfabrik, in Ziegeleien und im Stahlwerk Scounthorpe tätig zu werden.
Ich hatte zunächst das Pech, den unbeliebtesten Job zu bekommen, das Stahlwerk. Da fielen keine zusätzlichen Lebensmittel wie in der Landwirtschaft oder der Zuckerfabrik ab. Wie dem auch sei, ich war in Scounthorpe gelandet, und die Arbeit dort war dazu angetan, uns völlig verblöden zu lassen. Tagaus, tagein rannten wir mit Besen und Schippe in der Gegend umher, um Schienen – oder richtiger – die Weichen die in das Werk führende Eisenbahnen zu säubern, Unkraut zu jäten und die Werkshallen zu kehren. Ich weiß nicht, ob die baldige Einstellung dieses Arbeitskommandos darauf zurückzuführen war, daß wir uns so blöde anstellten und mehr Schaden als Nutzen verursachten, oder ob die Engländer einsahen, daß hier wertvolle Arbeitskraft vergeudet wurde. Wie dem auch gewesen sein mag, keiner weinte der Arbeit in Scounthorpe eine Träne nach. Der nächste Job klang vielversprechend: Arbeit in der Zuckerfabrik von Brigg. Da es sich anscheinend bei der Lagerleitung herumgesprochen hatte, daß ich ein einigermaßen passables Englisch sprach, wurde ich zu meiner großen Überraschung als Dolmetscher einer Schicht eingeteilt. Meine Aufgabe bestand darin, die Aufträge des englischen Vormannes an meine Kameraden weiterzugeben obwohl die keine Dolmetscher brauchten, da fast alle genug Englisch verstanden. Weiter hatte ich die Arbeitszettel zu führen, worin vermerkt wurde, was die Gefangenen in einer Schicht geleistet hatten. Daß wir in dieser Hinsicht den Engländern einen Bären aufbanden, verstand sich von selbst. Was in der Liste als geleistete Arbeit erschien, hatte mit der wirklich erbrachten Leistung wenig zu tun.
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß bemerkt werden, daß wir in der Fabrik sowohl von der Leitung als auch von den englischen Arbeitskräften sehr fair behandelt wurden und soviel Zucker essen durften, wie unser Magen vertrug. Man hatte auch nichts dagegen, daß wir eine Kakaodose voll Zucker von der Schicht mit ins Lager nahmen, um unseren täglichen Porridge genießbarer zu machen. Das alte Stichwort von der Kuh, die sich auf`s Eis begab als es ihr zu gut ging, sollte sich leider auch für Brigg bewahrheiten. Wir bekamen nämlich heraus, daß die Bewohner in der näheren und weiteren Umgebung von Brigg nicht abgeneigt waren, von den POWs Zucker gegen Geld zu erwerben. Anscheinend hielten sich die in der Zuckerfabrik beschäftigten Engländer an das „No pilfering“ Gebot bei dem Plakate an allen Wänden uns nachdrücklich einhämmerten, daß von ihnen keine Verbesserung der Zuckerrationen bei der Bevölkerung zu erwarten waren. Wir kümmerten uns natürlich einen Dreck um Gebote der Gewahrsamsmacht. Im Gegenteil, wir hatten alles, um uns unbeliebt zu machen, damit man uns endlich nach Hause schickte. So entstand zwangsläufig ein gut organisierter Zuckerhandel in der Gegend, der vielen POWs manches Pfund Sterling einbrachte. Der Ablauf war ganz einfach. Während der Nachtschicht kamen ganz speziell zusammengestellte Trupps aus dem Lager an dem Fabrikzaun und nahmen von der Nachtschicht entwendete Zuckersäcke in Empfang, die auf abenteuerlichen Wegen, teils mit gestohlenen oder von englischen Zuckerkunden geborgten Fahrrädern in Verstecke und von dort an den Mann gebracht wurden. Es war ein einträgliches Geschäft, das eine ganze Weile gutging aber schließlich auffliegen mußte, weil wir einfach die Grenzen des Zumutbaren überschritten. Auch Sorglosigkeit trug dazu bei, daß Lieferanten und Abholer in flagranti erwischt wurden. Ein ganzer Trupp geriet in einen Hinterhalt, den die englische Polizei an einer Kanalbrücke gelegt hatte, und ging nicht nur seiner Beute verlustig, sondern wanderte für geraume Zeit in den Knast. Unser Hostel wurde von der lukrativen Arbeit in der Fabrik ausgeschlossen und man holte sich andere Arbeitskräfte aus einem anderen Lager. Uns war es recht, denn allmählich hatten wir von dem Gestank in der Zuckerfabrik genug und Zucker mochten wir auch nicht mehr sehen.
Man ließ uns aber nicht auf unserer faulen Haut liegen, sondern schickte uns als nächstes in eine Zementfabrik, wo wir schwerste körperliche Arbeit zu leisten hatten. Sie bestand im Verladen der zentnerschweren Zementsäcke auf LKWs, eine Arbeit, die niemand von uns mochte. Verdreckt und erschöpft kehrten wir Abend für Abend in unser Camp zurück und verfluchten unser Schicksal.
Glücklicherweise sollte auch diese Arbeit nicht ewig dauern. Den Grund dafür schrieben wir uns selbst zu – arrogant wie wir noch immer waren. Da gab es die vielen geplatzten Zementsäcke, die den erschöpften POWs unbeabsichtigt von den Schultern auf den Boden fielen und den ungewöhnlich hohen Ausschuß durch aufgeschnittene Säcke, die angeblich beim Deponieren auf die Ladefläche der Lastwagen geborsten waren. Der wahre Grund für die Einstellung der Arbeit in der Zementfabrik war aber ein ganz anderer. Die britischen Streitkräfte kamen nach und nach von den Schlachtfeldern in Europa und im fernen Osten zurück, wurden zum großen Teil aus dem Wehrdienst entlassen und traten in vielen Fällen wieder ihre alten Jobs an. Der Krieg gegen Japan war ja auch in seiner letzten Phase und es hätte sicher nicht des Einsatzes von zwei Atombomen bedurft, wobei erstmals das ganze Grauen zukünftiger Kriege der Welt vor Augen geführt wurde, um die Japaner in die Knie zu zwingen.
Keiner der Verantwortlichen für diesen menschenverachtenden Einsatz wurde je vor ein internationales Tribunal gestellt. Der Zweck heiligt eben alle Mittel des Siegers. Da es inzwischen Zeit für die Bestellung der Felder geworden war, setzte man das Arbeitspotential der Kriegsgefangenen vermehrt in der Landwirtschaft ein. Auch ich wurde einem Kommando zugeteilt, das nahe Barton on Humber beim Großbauern Simpson tätig werden sollte. An und für sich hatten die Einsätze in der Landwirtschaft bei den Gefangenen einen guten Ruf, denn obwohl sie ihre Verpflegung mit zur Arbeitsstelle nahmen, steuerten die klugen Farmer immer etwas zu ihrem einfachen Mahl bei, sei es ein Huhn, Eier oder Kartoffeln. Zu diesen klugen Farmern gehörte Mr. Simpson jedoch leider nicht, es gab weder Zusatzverpflegung noch war er bereit, auf dem täglichen Arbeitszettel des Kommandos zu bestätigen, daß die Gefangenen besser als „satisfactory“ gearbeitet hatten, was einen Abzug bei dem schon lächerlich geringen Arbeitslohn zur Folge hatte. Den Schaden hatten die geizigen Farmer aber selber. Sie waren die Ursache dafür, daß in England auf dem Lande die Meinung vorherrschte, seit dem Eintreffen der POWs auf den Farmen legten die Hühner nur noch an den Sonntagen Eier.
Es traf zu, daß wir einen guten Riecher dafür entwickelt hatten, wo Hühner ihre Eier legten. Die Nester wurden geplündert und die Beute in rohem Zustand ausgeschlürft. Mr. Simpson büßte jedoch nicht nur Eier ein, er ging auch etlicher Hühner verlustig. Unsere Mittagspause auf seinem Hof verbrachten wir in einem alten Schuppen, in dem wir mit einem üblen Trick, ähnlich der Liste von Max und Moritz, die Hühner in den Stall zu locken versuchten. Wir legten eine Spur Brotkrümel vom Futterplatz der Hühner bis in den Schuppen, dessen Tür wir weit offenließen. Und siehe da, es dauerte gar nicht lange, da bewegten sich die ersten Hühner der Spur entlang in Richtung Stall. Kaum waren etliche Hühner in der Falle, also im Stall verschwunden, sauste einer von uns wie ein geölter Blitz hinterher und ein anderer warf die Tür hinter ihm zu. Die Protestschreie der gefangenen Hühner verstummten bald und wenig später öffnete sich die Tür und ein triumphierender, leicht zerzauster POW erschien mit seiner Beute, drei toten Hühnern. Sie wurden noch in der Mittagspause gerupft, die Federn vergraben und – nunmehr nackt – in die Essenkübel verstaut. Unbeschadet gelangte die Beute ins Lager und wir hatten ein schmackhaftes Mahl. Mr. Simpson geriet jedoch vollends in Ungnade bei uns bei einem Ereignis, bei dem seine ganze Schäbigkeit zu Tage trat. Wir hatten Heu gewendet, und Simpson erschien zur Kontrolle und verschwand bald wieder. Aus irgendeinem Grund muß er bei der Kontrolle seine uralte und sicher sehr kostbare Taschenuhr, die wir alle gut kannten, weil er mit ihr oft unser Arbeitstempo kontrollierte, verloren haben. Einer von uns fand sie durch Zufall und wir überlegten lange, was wir mit der Uhr anfangen sollten. Schließlich kamen wir zu dem Schluß, daß es unfair wäre, sie zu behalten, da es sicher ein altes Familienstück war, an dem er hing. Einer von uns übergab sie Simpson bei seiner nächsten Kontrollvisite und zu unserer großen Verwunderung steckte er die Uhr ohne ein Wort des Dankes in seine Tasche und verschwand. Wir dachten, daß er seinen Dank vielleicht in anderer Weise abstatten und uns am Abend vor der Fahrt ins Lager einige Lebensmittel mitgeben würde – aber Pustekuchen, nichts dergleichen geschah. Er ließ sich nicht einmal blicken. Bitter enttäuscht beschlossen wir, ihm dies bei passender Gelegenheit heimzuzahlen. Die Gelegenheit ergab sich bald. Als wir eines Tages zum Hacken junger Rübenpflanzen eingeteilt wurden, fingen wir zwar mit unserer Arbeit an, hörten aber sofort auf, als Simpson das Feld verlassen hatte und legten uns auf dem Rübenpfad in die Sonne. Als er nach einiger Zeit wieder auftauchte, sprangen wir auf Pfiff auf und zogen meterweit sämtliche Rübenpflanzen raus. Simpson lief blau an, so daß wir schon dachten, er würde einen Kollaps bekommen. Das geschah zwar nicht, aber er belegte uns mit den wüstesten Flüchen und befahl uns, sofort auf den Hof zurückzukehren und unser Werkzeug abzugeben. Er rief dann wahrscheinlich das Lager an, denn bald darauf erschien unser LKW und brachte uns ins Lager zurück. Wir meldeten den Vorfall unserem deutschen Lagerführer, der bald darauf zum englischen Lagerführer gerufen wurde und diesem den Hintergrund und den Anlaß unseres Handelns erklärte. Der Tommy hatte anscheinend Verständnis und außer der Tatsache, daß wir den Hof von Simpson nie wiedersahen, ereignete sich nichts. Im Gegenteil, wir hatten erst einmal eine Ruhepause, ehe man uns wieder für würdig befand, in einem Arbeitskommando eingesetzt zu werden. Schließlich war es soweit. Zusammen mit fünf anderen Kameraden landete ich in einem Kommando, das in einer Ziegelei in Ferriby Sluice unweit der Humber eingesetzt wurde. Die tägliche Fahrt dorthin auf einem LKW dauerte fast vierzig Minuten und schmeckte uns gar nicht. Aber was solls, wir waren erst einmal auf Ferriby Sluice festgelegt. Die Ziegelei war ein mittelgroßer Betrieb und litt unter Arbeitskräftemangel. Kein Wunder, die Arbeit war knochenhart und die Bezahlung selbst für englische Verhältnisse nicht toll. So waren wir dazu ausersehen, die Lücke zu schließen. Der „brickyard“ wurde von Seniorchef, Mr. Frank, einem älteren, würdigen Herrn und dessen Sohn geleitet. Das Arbeitsklima war gut und wir kamen mit unseren englischen Kollegen, zumeist älteren Arbeitern, gut aus. Natürlich bekamen wir immer die Jobs, die sie nicht mochten. Daß das nicht die Produktivität steigerte, versteht sich von selbst. Es wurde erst anders, als der Seniorchef auf die Idee kam, den Gefangenen einen eigenen Brennofen zuzuweisen, und ihnen selbstständig die Herstellung von Ziegeln – von der Lehmgrube über das Formen der Ziegel, das Beschicken des Ofens, die Überwachung des Brennens und die Entladung des Ofens – überließ. Dazu war es aber erforderlich, daß wir in unmittelbarer Nähe unserer Arbeitsstätte wohnten, da die Überwachung des brennenden Ofens rund um die Uhr zu geschehen hatte. Einem Antrag des Chefs bei unserer Lagerleitung wurde stattgegeben und wir zogen mit Sack und Pack in eine leere Halle der Ziegelei, die schmutzig und unfreundlich war. Zunächst bauten wir uns aus zugewiesenem Material Holzkojen, die wir mit unseren Strohsäcken versahen, so daß wir erst einmal einen Platz zum Pennen hatten. Dann folgte eine eigene Säuberung und unter der Leitung unseres Kommandoführers, eines gelernten Mauerers, bauten wir uns in der Halle ein abgetrenntes Wohn- und Schlafzimmer, sowie eine Küche. Damit war die Grundlage dafür gelegt, daß wir uns wohlfühlten, eine Voraussetzung für den erforderlichen Arbeitseifer, wie auch die Verpflegung. Wir bekamen die gleichen Rationen wie unsere englischen Arbeitskollegen. Ein Großteil der Lebensmittel war zu dieser Zeit in England noch rationiert, obwohl es das eine oder andere auch schon ohne Marken gab, wie z. B. Käse und einige Konserven. Für den Einkauf der meisten Lebensmittel waren wir auf einen Tante-Emma-Laden in Ferriby Sluice angewiesen, während der Chef persönlich unsere Fleischrationen besorgte, die meist nur für einen Sonntagsbraten reichte. Ich war dazu ausersehen, die übrigen Lebensmittel aus dem kleinen Laden zu besorgen, wobei mir das finanzielle Limit vorgegeben war. Die Besitzerin des Ladens, eine ältere Dame, und ihre Tochter, die mit ihr zusammen den Laden betrieb, war uns wohlgesonnen und so fiel ab und zu etwas ab, was uns eigentlich nicht zustand. Die Arbeit machte Spaß, obwohl sie körperlich ganz schön schlauchte. Es war einfach etwas anderes, wenn man mit einem Team, das sich gut verstand, ziemlich selbstständig darüber entschied, wieviel man produzierte. Es entstand auch so etwas wie Stolz auf das fertige Produkt, das unser Werk war. Leider verfielen wir in die deutsche Gewohnheit, alles besser zu machen als unsere englischen Kollegen und vor allem sie in den Produktionszahlen zu übertreffen. Sie sahen das nicht gern und machten aus ihren Herzen keine Mördergrube, als sie uns zu verstehen gaben, daß wir aus Solidarität mit ihnen doch etwas kürzer treten sollten, denn, von unserem übertriebenen Arbeitseifer profitiere doch nur der Kapitalist Frank. Wir sahen das ein und fortan sprachen wir miteinander ab, wie viele Ziegel wir pro Tag produzieren wollten. Somit war der Arbeitsfrieden wiederhergestellt, und die englischen Kollegen waren nicht mehr sauer auf uns. Das gute Einvernehmen führte schließlich dazu, daß sie uns sogar in den Dorfpub mitnahmen und uns bei einem englischen Bier in die Geheimnisse des Dart-Spieles einführten. Wir genossen zu diesem Zeitpunkt schon eine gewisse Freiheit, Wachen hatten wir keine mehr bei uns, und wir durften uns im Umkreis von 5 Meilen von unserem Arbeitsplatz frei bewegen. Der Krieg war bereits über ein Jahr zuende, aber unsere Repratriierung zeichnete sich noch nicht ab. Es sollte noch ein ganzes Jahr vergehen, ehe ich die Reise nach Deutschland antreten durfte.
Mr. Frank der Ältere brachte mir ein gewisses Wohlwollen entgegen. Er gab mir zu verstehen, daß ich unter normalen Umständen wohl kaum in einer Ziegelei arbeiten würde, es sei denn als Boss. Eines Tages fragte er mich, ob ich wohl mit einer Sense umgehen könne, das Gras im Garten seines Hauses mußte dringend geschnitten werden. Da ein POW alles konnte, wenn er sich davon einen Vorteil versprach, sagte ich natürlich, daß ich zwar kein Experte mit der Sense sei, aber so ein Ding schon mal in der Hand gehabt hatte. So marschierte ich eines Abends nach Schluß meiner Schicht zum Haus von Mr. Frank, um ihm meine Künste mit der Sense zu demonstrieren. Es ging besser, als ich selbst vermutet hatte, und die Wiese sah nach meinem Einsatz ganz passabel aus. Zu meinem Erstaunen war auch Mr. Frank mit meiner Arbeit zufrieden und lud mich zu einer Tasse Tee in sein Haus. Dort lernte ich seine Frau kennen, eine sehr nette alte Dame, die ihr Los mit dem Mitleid für die Gefangenen nicht verhehlte. Sie verwöhnte mich mit gutem Tee und Plätzchen und gab mir noch ein paar Sandwiches mit Corned Beef mit auf den Heimweg. Ich wurde nun öfter in das Heim der Franks eingeladen und lernte die Familie kennen und schätzen. Eines Tages fragte mich Mrs. Frank, ob ich nicht das Bedürfnis habe, zur Kirche zu gehen, da ich doch sicher aus einem christlichen Hause käme. Natürlich beteuerte ich, daß ich das sehr gern täte, obwohl ich seit meiner Einsegnung keine Kirche mehr betreten hatte. So marschierte ich eines Sonntags mit den beiden alten Herrschaften zur Kirche von Ferriby Sluice, versehen mit einem Sixpence, den mir Mrs. Frank für die Kollekte zugesteckt hatte. Der wanderte aber nicht in den Klingelbeutel, sondern verblieb in meiner Hosentasche und ein alter Knopf fand an seiner Stelle den Weg in den Klingelbeutel. Das Ritual der anglikanischen Kirche war mir zwar fremd, aber ich hielt mich an das, was die anderen taten und fiel nicht dumm auf. Ich sang sogar die Lieder mit, obwohl ich in meiner alten Penne als Brummer keinen Zutritt im Schulchor gefunden hatte. Der sonntägliche Kirchgang wurde nun zu einem festen Bestandteil meines Gefangenenlebens, und um ehrlich zu sein, ich gewann Gefallen daran, und steckte auch manchmal den Sixpence in den Klingelbeutel. Mr. Frank stellte mich nach dem Kirchgang auch seinen Bekannten vor, und betonte immer, daß der arme „lad“ der einzige Überlebende eines German submarine und ein Midshipman ( Fähnrich ) sei. Mein Englisch wurde von allen gelobt, nur meine englischen Arbeitskameraden sagten, daß ich nicht wie ein „bloody MP (Member of Parliament)“ reden solle. So richtete ich mein Englisch nach den Leuten ein, mit denen ich sprach. Schulenglisch für die Kirchgänger und kanadisches „Lumberjack“ Holzfäller-Englisch für die Arbeitskollegen. Ich wurde auch von Mr. Frank Junior eingeladen und durfte sogar mit dessen Sohn, einem kleinen arroganten Bengel, und seiner Cousine Brenda am Humber spazierengehen. So verlebte ich eine angenehme Zeit in Ferriby Sluice und hätte es dort bis zu meiner Repatriierung ausgehalten, aber es kamen Ereignisse auf mich zu, die ich nicht voraussehen konnte, und die vieles ändern sollten. Um uns zusätzlich Geld zu verdienen nahmen wir das Angebot von Frank Junior an, nach unserer normalen Arbeit einen Leichter, der mit Palmkernen beladen war, zu löschen, eine Arbeit, die mehrere Abende in Anspruch nahm. Über der Ladeluke waren Planken ausgelegt, die eine Plattform bildeten, auf der wir mit unseren Schubkarren fuhren, um Körbe mit Palmkernen, die mit einer Winsch aus dem Laderaum gehievt wurden, aufzunehmen und über eine Planke ans Ufer des Kanals und weiter in eine leere Lagerhalle der Ziegelei zu transportieren. Das ging zunächst auch alles sehr gut und war keine ausgesprochen schwere Arbeit, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hatte, die Karre mit den hohen Körben im Gleichgewicht zu halten. Meist arbeiteten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit und nahmen bei Arbeitsende unseren täglichen Lohn in Empfang, für den wir uns kleine Annehmlichkeiten wie Zigaretten, Tabak und Kakao kauften. Eines Tages passierte mir jedoch ein Mißgeschick, das mein POW-Leben verändern sollte. Ich war wieder einmal mit meiner Karre an der Plattform angelangt, um meinen Korb mit Palmkernen von der Winsch aufzuladen, als die Karre Übergewicht bekam, weil der Korb nicht ordentlich auf der Karre landete. Um ein Herunterstürzen der Karre samt Ladung zu verhindern, versuchte ich vergeblich, sie zu halten. Da ich die Griffe der Schubkarre nicht losließ, wurde ich samt Karre und Kiepe in die Ladeluke hinabgerissen. Ich konnte nur noch schreien: „Weg!“, dann landete ich unsanft auf allen Vieren in einem Berg von Palmkernen. Da ich gute vier bis fünf Meter in die Tiefe gestürzt war, blieb ich zunächst benommen und mit einem leichten Schock in den Kernen liegen. Meine Kameraden stürzten herbei und stellten fest, daß ich eine schwere Verstauchung des rechten Handgelenks davongetragen hatte, aber sonst bis auf einige Kratzer heilgeblieben war. Sie schafften mich an Land und riefen das Lager an, um mich einem Arzt vorzustellen. Als ich nun im Grase an einer Kanalböschung saß, kam die Frau eines der englischen Arbeiter vorbei, um ihrem Mann etwas zu bringen. Sie sah mich an und murmelte: „Poor little boy“, eilte nach Hause und kam nach kurzer Zeit mit einem Kuchen wieder, den sie mir in die Hand drückte. Sie lächelte mich an und ich grinste dankbar zurück. Rose hieß sie und bestand darauf, bei mir zu bleiben, bis ein Sanka kam, um mich abzuholen. Im Lager stellte unser englischer Arzt fest, daß das Handgelenk nicht gebrochen war, ich jedoch einige Tage krankfeiern müsse. Ich drückte mich also in den nächsten Tagen im Lager herum langweilte mich und war voller Unruhe. Zu gern wollte ich Rose wiedersehen. Endlich wurde ich wieder arbeitsfähig geschrieben und mit Sack und Pack brachte mich ein LKW zu meiner alten Arbeitsstätte, der Ziegelei in Ferriby Sluice. Ich bekam auch gleich wieder meinen alten Job, die Versorgung des Kommandos mit Lebensmitteln. Meine Wohltäterin sah ich zunächst nicht wieder, obwohl ich mich abends oft in der Nähe ihres Hauses herumdrückte. Eines Tages aber fragte mich ihr Mann, ob ich nicht Lust hätte, zu ihnen zum Supper zu kommen. Da sagte ich nicht nein. Um nicht mit leeren Händen zu kommen, pflückte ich was ich fand an Wiesenblumen und bekam einen ganz passablen Strauß zusammen. Als ich dann aber damit bei meinen Gastgebern erschien, brach sie in lautes Gelächter aus. Ob ich wohl zu einer Beerdigung gehen wolle, fragten sie. Andere Länder, andere Sitten eben.
Rose nahm aber doch meine Blume an, und ich erklärte ihr, daß man bei uns zu Hause immer Blumen für die Hausfrau mitnähme, wenn man eingeladen sei. Es wurde ein ganz vergnüglicher Abend, und das Essen, Steak und Kidney Pie, war nicht zu verachten. Nach dem Essen folgte ich Rose in die Küche, um das Geschirr abzutrocknen. Sie lächelte mich an, kam auf mich zu, nahm mir das Küchentuch und den Teller aus der Hand und mich in ihre Arme. Es war der erste Kuß nach dreieinhalb Jahren und ebenso lange her, daß ich einen Frauenkörper berührt hatte; als sie mich losließ, mußte ich mich abwenden. Sie schien amüsiert über meine heftige Reaktion, und flüsterte: „We will meet very soon, and I will make you happy.“
Rose war mindestens 15 Jahre älter als ich und hatte eine Figur, die einen ausgehungerten POW unruhig werden lassen konnte. Aber es sollte noch eine Zeit vergehen, bis sie ihr Versprechen erfüllte. Zunächst belegte mich ihr Sohn James mit Beschlag, und wir gingen zusammen aus nach Scunthorpe, die Stadt, die ich in schlechter Erinnerung hatte. Er schleppte mich, ausstaffiert mit einem Anzug seines Vaters, zu einem Fotografen und es entstanden Fotos, die der Fotograf so retouchierte, daß ich mich kaum wiedererkannte. Ich sah aus wie ein Pin-up-Boy. Roses Sohn, nahm eines der Fotos mit zu seiner Arbeitsstätte im benachbarten Barton und zeigte es seinen Arbeitskollegininnen. Eine war davon so angetan, daß sie sich mit mir verabreden und ins Kino gehen wollte. Rose hatte nichts dagegen einzuwenden, und so marschierte ich mit James nach Barton, wo er mir seine Arbeitskollegin vorstellte und dann sofort verschwand. Sie war eine kleine pummelige Rothaarige und keine geistige Toplaterne. Wie dem auch sei, wir gingen ins Kino und sahen nicht viel von dem Film. Aber wiedersehen wollte ich sie nicht. Ich war viel mehr von Rose und ihren Reizen angetan.
In der Ziegelei passierte indes unserem Team ein Mißgeschick. Einer von uns, der den Brennofen nachts zu überwachen und für die richtige Temperatur zu sorgen hatte, war ganz einfach eingepennt. Das Resultat war ein zusammengeschmolzener Ofeninhalt, den wir mit Pickeln und Schaufeln in knochenbrechender Arbeit herausholen mußten. Statt Ziegel der Klasse 1 und 2 gab es nun Ziegelschrott, der nur noch zum Auffüllen von Schlaglöchern auf Feldwegen zu gebrauchen war. Unsere englischen Arbeitskollgen feixten, als uns die Leviten gelesen wurden. Der Boss feuerte den Schläfer jedoch nicht, was eine Rückkehr ins Lager bedeutet hätte, sondern beließ es bei einer Verwarnung. Hans, unser deutscher Kommandoführer hatte aber Frank gegenüber auch angedeutet, daß wir aus Solidarität mit dem Übeltäter ins Lager zurückgehen würden, wenn man ihn feuerte. Roses Mann hatte inzwischen gekündigt und sich einen neuen Arbeitsplatz in Scunthorpe im Stahlwerk besorgt, weil er dort mehr verdienen konnte. Er kam, wenn überhaupt, erst sehr spät abends nach Hause und als ich Rose zufällig an einem Sonntag traf, verabredeten wir uns für den nächsten Abend. Wir trafen uns nach Einbruch der Dunkelheit bei einem kleinen Gehölz und da geschah, was ich seit über drei Jahren nicht erlebt hatte. Wir fielen uns in die Arme, küßten und berührten einander und wurden glücklich in dieser Nacht. Und es blieb nicht bei diesem ersten Rendezvous, wir trafen und liebten uns so oft wir konnten, und ich, der unerfahrene Junge, ließ mich von ihr verwöhnen. Leider aber immer, wenn es dem Esel zu gut geht, begibt er sich aufs Eis. So war ich anscheinend aus zwei Gründen bei meinem Boss, dem alten Mr. Frank, in Ungnade gefallen. Er sah meine enge Verbindung zu der Familie eines seiner Arbeiter nicht gern – da hatte ich mich als Midshipman mit Leuten abgegeben, die nicht zu seiner und meiner Klasse gehörten – und hatte darüber hinaus das uns zustehende Verpflegungsgeld stets bis auf den letzten Penny ausgegeben. Beides schmeckte ihm nicht, besonders Letzteres, da er bei den Arbeitern als geizig angesehen war und noch von unserem Verpflegungsgeld profitieren wollte. Es ergab sich bald eine günstige Gelegenheit, um mich und einen anderen meiner Kameraden loszuwerden. Er benötigte durch die Zuweisung von zwei seiner englischen Arbeitern zwei POWs weniger und seine Wahl der ins Lager Zurückzuschickenden fiel auf meinen Freund Egon H. und mich. Die Trennung von Ferriby Sluice sollte aber nicht die Trennung von Rose bedeuten, das schworen wir uns beide am Abend vor meiner Zurückverlegung in das Hostel Elsham Hall.
So verstauten wir am nächsten Morgen unsere sieben Sachen in unseren Seesäcken und mit dem Versprechen, daß wir unsere Kameraden ab und zu besuchen würden, fuhren wir zurück. Die ersten Tage fühlten wir uns dort überhaupt nicht wohl, weil wir das Zusammengepferchtsein mit 50 Mann in einer der schäbigen Nissenhütten nicht mehr gewohnt waren. Es war wie der Umzug aus einem Hotel in eine Jugendherberge. Wir mußten auch erst wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden, was aber nicht allzu lange in Anspruch nahm. Es waren ja zum Teil auch noch Leute in der Baracke, die wir von früher her kannten, und mit denen wir auf der einen oder anderen Arbeitsstelle zusammengearbeitet hatten. Wir wurden zunächst keiner Arbeitsgruppe zugeteilt, und so hatte ich Zeit und Muße, mich mit Rose zu treffen. Sie hatte mir bei unserem letzten Zusammensein in Ferriby englisches Geld für die Busfahrt von Elsham nach Ferriby zugesteckt und wir hatten dabei schon den Termin für unser nächstes Treffen ausgemacht. Zivilklamotten hatte ich auch von ihr bekommen und so war ich, mit einem alten Anzug und einer Schiebermütze ihres Mannes ausgestattet, nicht von den Eingeborenen zu unterscheiden. Frech wie ich war, wartete ich auf den Bus an der unweit des Lagers gelegenen Haltestelle, bestieg diesen und bekam auf mein mürrisches „Ferriby return!“ eine Rückfahrkarte ausgehändigt. Keiner der anderen Fahrgäste nahm auch nur die geringste Notiz von mir, und nach einer etwa halbstündigen Fahrt stieg ich in Ferriby Village aus und marschierte die Straße hinunter nach Ferriby Sluice zur Andrew`s Row, wo Rose wohnte. Es war am späten Vormittag, und Rose war allein. Sie hatte mir kaum die Tür geöffnet, da lagen wir uns schon in den Armen und Rose flüsterte: „Lets go upstairs, Bill.“ Upstairs war das Schlafzimmer, und an diesem Vormittag liebten wir uns zum ersten Mal in einem Bett. Als ich Roses Kleidung abgestreift und mich selbst meiner Kleidung entledigt hatte, geschah etwas Merkwürdiges: Rose bedeckte ihre Augen mit einem Arm als schämte sie sich, den Körper ihres Geliebten bei Tageslicht anzuschauen. Sehr bald vermochte aber unsere gegenseitige Zärtlichkeit, daß sich ihre Augen am Körper des Geliebten erfreuten. Wir hatten Zeit und Muße uns ganz unserer Lust hinzugeben. Erschöpft schliefen wir später ein. Als ich erwachte, war Rose schon längst angezogen und sagte lachend zu mir: „You ought to be very hungry now, Bill!“
Bei Gott, ich war hungrig wie ein Wolf und genoß alles, was Rose auftafelte. Viel zu schnell verging der Nachmittag, und es wurde Zeit, zur Bushaltestelle zu gehen. Eine letzte Umarmung, und mit der Zusicherung, daß sie mich an einem der nächsten Tage nahe der Bushaltestelle bei unserem Lager treffen würde, machte ich mich auf die Heimreise. Wie auf der Fahrt nach Ferriby nahm auch auf der Rückfahrt nach Elsham keiner der Fahrgäste des Busses Notiz von mir, und ich gelangte ohne Zwischenfall in das Lager zurück. Unserer Verabredung entsprechend trafen wir uns einige Tage später in der Nähe des Lagers und stellten fest, daß nichts über die Liebe im Bett gehe. Doch dazu sollte es erst nach einiger Zeit wieder kommen. Ich wurde für vierzehn Tage einer Arbeitsgruppe zugeteilt, die am Humber die Uferbefestigung ausbessern sollte. Diese eintönige Arbeit wurde noch erschwert durch die Tatsache, daß vom gegenüberliegenden Hull die Schiffstransporte mit nach Deutschland zurückkehrenden Kriegsgefangenen abgingen. Der Gedanke an die vermeintlich vom Schicksal Begünstigten, die nach Hause fahren durften, war nicht dazu angetan, unseren Arbeitseifer zu vergrößern. Wir trösteten uns aber mit der Vorstellung, daß auch wir eines Tages auf einem Schiff von Hull nach Cuxhafen in die absolute Freiheit fahren würden.
Bis dahin sollte aber noch eine Menge Wasser den Humber hinab in die Nordsee fließen. Nachdem wir unsere Arbeit am Humber beendet hatten, lagen wir wieder im Camp auf der faulen Haut und vertrieben uns die Zeit auf die Art aller Kriegsgefangenen: Uns in der Gegend umzusehen und alles zu organisieren (auf bürgerlich deutsch: stehlen), was uns unter die Finger geriet. Egon und mich führten unsere Streifzüge eines Tages zu dem ehemaligen RAF-Fliegerhorst Elsham. Der Fliegerhorst war verlassen; außer einigen Nissenhütten und der Startbahn gab es nichts, was noch an einen Flugplatz erinnerte. Neugierig unterzogen wir die Hütten einer genauen Untersuchung, und zu unserer Überraschung und Freude stellten wir fest, daß in einer mit einem Vorhängeschloß versehenen Hütte eine große Zahl von Fahrrädern, die mit der Kokarde der RAF versehen waren, stand. Ein Vorhängeschloß zu knacken war für einen alten Kriegsgefangenen eine Leichtigkeit, und in Null Komma Nichts waren wir in der Hütte. Die Fahrräder, etwa zwanzig an der Zahl, waren in tadellosem Zustand; nur die RAF-Kokarde am hinteren Schutzblech störte uns. Wir beschlossen zunächst, in der kommenden Nacht zwei Fahrräder zu entführen, und zu versuchen, die Kokarden zu entfernen und das Schutzblech mit einem anderen Anstrich zu versehen. Wir befestigten das Vorhängeschloß wieder an der Hüttentür und verwischten so gut es ging die Spuren unserer Anwesenheit. Auf dem Weg zurück ins Lager beratschlagten wir wo, und wie wir wohl die Fahrräder von ihrem RAF-Status befreien könnten. Es kam uns dann schließlich die grandiose Idee, uns an unseren Politkommissar (einen Absolventen von Wilton Park, der zu unserer Umerziehung zu anständigen Menschen beitragen sollte) zu wenden. Dieser bewohnte allein eine Hütte, in der auch unter anderem das Material für die Instandhaltung des Lagers aufbewahrt wurde. Raum und Material für unser Vorhaben waren also vorhanden, es fragte sich nur, ob der Wilton-Park-Knabe, der bisher im Lager keine große Resonanz gefunden hatte, mitziehen würde. Wir wollten es aber auf einen Versuch ankommen lassen, suchten ihn auf und fielen ohne viele Vorreden gleich mit der Tür ins Haus. Zu unserem großen Erstaunen erhob er keine Einwände und war bereit, die beiden Fahrräder in seiner Hütte unterzubringen und uns auch mit der Farbe für ihre Verwandlung in den zivilen Status behilflich zu sein. Es versteht sich von selbst, daß er dadurch in unserer Achtung stieg und wir ihn von diesem Zeitpunkt an mit anderen Augen betrachteten. Wir weihten auch zwei andere Kameraden in unseren Plan ein, da wir für die Sicherung des Unternehmens nicht mit uns allein auskamen. So zogen wir schließlich zu viert in der Dunkelheit los und fanden heraus, daß auf dem Fliegerhorst absolute Stille herrschte. Und die Luft rein war. In kurzer Zeit waren die beiden Fahrräder aus der Baracke heraus, und wir fuhren auf zwei Fahrrädern auf Schleichwegen ins Lager zurück. In der Sicherheit der Hütte unseres Wilton-Park-Freundes gingen wir sofort daran, die Fahrräder umzufunktionieren. Diese Räder wollten wir behalten, um sie bei unseren weiteren Streifzügen als Transportmittel zu benutzen; für die übrigen Räder wollten wir zunächst Kunden bei der Zivilbevölkerung suchen und sie dann peu a peu verscheuern.
Ich hatte an diesen geschäftlichen Transaktionen aber keinen Anteil, weil ich nun im Besitz eines fahrbaren Untersatzes jeder Zeit nach Ferriby zu Rose fahren konnte, und das tat ich ausgiebig: Sommer und Herbst 1946 werden mir als glückliche Zeit immer in Erinnerung bleiben.
Nur einmal auf der Fahrt nach Ferriby schwitzte ich Blut und Wasser. Da kam mir kurz vor dem Ort hoch zu Fahrrad der Dorfpolizist von Ferriby entgegen. Dem war ich schon öfter begegnet; hatte er uns doch in der ersten Zeit unserer Anwesenheit in der Ziegelei öfter heimgesucht, um festzustellen, ob wir auch brav waren und keinen Unsinn verzapften. Da ich aber meine Schiebermütze tief in die Stirn gezogen hatte, erkannte er mich nicht, und ich kam unbehelligt davon.
Die Nachbarin von Rose hatte inzwischen meine häufigen Besuche bei Rose mitbekommen, ließ aber nichts davon verlauten und bat mich sogar eines Tages in ihr Haus, als ich Rose nicht antraf, weil sie im Dorf zum Einkaufen war. Sie bot mir eine Tasse Tee an und gab zu verstehen, daß sie Rose zu ihrem „young german lover“ beglückwünschte. Von dieser Seite drohte also keine Gefahr für unsere Schäferstündchen. Als ich eines Abends in der Dunkelheit zum Lager zurückfuhr, blieb plötzlich auf der Mitte der Straße ein Wildkaninchen, geblendet von meiner Fahrradbeleuchtung wie erstarrt hocken und ich hatte nichts besseres zu tun, als ihm mit der Fahrradpumpe den Garaus zu machen und es als Sonderration meinen Kameraden im Lager mitzubringen.
In der Zwischenzeit hatten wir im Lager Zuwachs bekommen: Ungefähr vierzig junge Burschen von der SS-Division Hitler-Jugend, die man nach ihrer Entlassung wieder eingefangen und nach England transportiert hatte. Im Gegensatz zu uns, die wir alle schon 23 Jahre älter waren, waren sie fast noch Kinder, kaum einer über siebzehn. Sie waren natürlich furchtbar sauer über ihre Gefangennahme im Frieden und machten aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Alle trugen sie das Kainsmal der eintätowierten Blutgruppe unter dem Arm und mußten für Untaten herhalten, die von SS-Verfügungstruppen als Teil der SS begangen worden waren.
Uns taten die jungen Burschen leid, und wir bemühten uns um sie und brachten ihnen die vielen Tricks bei, mit denen man sich das Leben als Gefangener leichter machen konnte. Da die Zeit der Kartoffel- und Rübenernte gekommen war, wurden nun vermehrt Arbeitskommandos für die Farmen abgestellt. Um ehrlich zu sein, wir hatten keinen Bock mehr, eineinhalb Jahre nach Ende des Krieges als billige Arbeiter für die Sieger herzuhalten und machten unserem Unmut auf den Arbeitsstellen und dem Wege dorthin Luft. In mühseliger Arbeit fertigten wir Flugblätter, die wir auf der Fahrt zu oder von der Arbeitsstelle in den Ortschaften von unseren LKWs herunterwarfen. Sie trugen Aufschriften wie: „Britons send your slaves home! “ und „We have parents, wifes and children waiting for us in Germany, christians send us home!”
Eines Sonntags während eines Streifzuges in der Umgebung stießen wir in einem verlassenen Steinbruch auf Unmengen von alten Förderbändern aus Hartgummi. Einer von uns hatte die grandiose Idee, daß dieses Zeug doch herrvorragend für Sohlen von Hausschuhen und Slippers, geeignet wäre. Man benötigte nur noch Material für das Oberteil der Puschen und konnte dazu aus Bindegarn Zöpfe pflechten diese zusammennähen und mit den Sohlen verbinden. Das Weitere war reine Routine. Wir transportierten unsere Beute fein säuberlich auf transportable Länge zurechtgeschnitten ins Lager. Der nächste Schritt war das Organisieren von Bindegarn, was sich einfach bewerkstelligen ließ. Alle in der Landwirtschaft eingesetzte Arbeitsgruppen wurden beauftragt, so viel Bindegarn von ihren Arbeitsstellen wie möglich mitgehen zu lassen. Wir, die Organisatoren, kauften das Garn gegen Zigaretten oder Bargeld auf, und die handwerklich geschickten unter uns machten sich dann an die Herstellung der Hausshuhe. Um diesen Puschen ein attraktives Aussehen zu verleihen, wurde das Bindegarn bunt gefärbt. Den Farbstoff konnten wir nicht klauen, sondern mußten ihn kaufen, die einzige Ausgabe die wirklich zu Buche schlug. Ich konnte mich leider nicht an der Herstellung der Puschen beteiligen, da ich keinerlei handwerkliches Geschick besaß. Durch meine Bekanntschaft mit Rose lernte ich aber einen englischen Zivilisten kennen, der einige Schwarzmarktkenntnisse zu besitzen schien. Er schlug mir vor, nachdem ich ihn mit unser Slipperproduktion bekanntgemacht hatte, einen Absatzmarkt zu erschließen, der für alle von uns lohnend wäre. Ich sollte ihm erst einmal auf Treu und Glauben ein Sortiment als Muster für eventuelle Kunden aushändigen und dann würden wir sicher bald ins Geschäft kommen.
Gesagt, getan, bewaffnet mit einer Musterkollektion in einem Sack auf dem Gepäckträger meines Fahrrades übergab ich die Ware Rose bei meinem nächsten Besuch, und es dauerte gar nicht lange, da rollten die ersten Schillinge für unser Unternehmen. Es war eine ganz einfache, sicher für alle Beteiligten lohnende Rechnung. Ich zahlte den Produzenten fünf Schilling pro Paar, erhielt von meinem Mittelsmann acht Schillinge, und er und der Endverkäufer gingen sicher auch nicht leer aus. Das Geschäft florierte eine ganze Weile, bis die Slipper-Produktion aus Mangel an Material für die Sohlen – die Transportbänder waren aufgebraucht – zum Erliegen kam. Wir stiegen nun auf einen neuen Artikel um, der sich aber nicht so gut verkaufte: die Firma produzierte nun Matten und Bettvorleger. Eine Weile verdienten wir mit den Matten noch manchen Schilling, schließlich lief aber die Produktion aus; hinterließ aber allen Beteiligten einen ganzen Batzen Geld, das wir nutzbringend für die Annehmlichkeiten des Lebens anlegten. Die Ware, die wir erwarben, bildete auch einen guten Grundstock für all die Dinge, mit denen man sich eine ganze Zeit in Deutschland über Wasser halten konnte.
Inzwischen war auch der Winter eingebrochen, ein besonders strenger, der viel Schnee und große Schneeverwehungen mit sich brachte. Der Versuch der Gewahrsamsmacht, die Gefangenen zum Schneeräumen einzusetzen, war ein Schlag ins Wasser. Bewaffnet mit Schaufeln bezogen wir zwar unsere Arbeitsräume, waren aber nicht besonders bemüht, die Straßen passierbar zu machen. Meistens bauten wir uns in einer Schneewehe einen halben Iglu, montierten Feuerholz von den benachbarten Weidezäunen ab und machten es uns mit einer Pfeife Tabak vor dem wärmenden Feuer bequem. So verging der Winter 1946/47 ohne irgendwelche Höhepunkte. Sobald es die Wetterlage zuließ, schwärmten wir in der Umgebung aus, um Brennbares zu ergattern, denn die Nissenhütten waren kalt wie Eiskeller, und die Zuteilung an Brennholz äußerst dürftig. Im Verlauf der Suchaktionen statteten wir auch den in der Nähe gelegenen Bahnhöfen Besuche ab, um die Kohlenvorräte für die Dampfloks zu dezimieren. Der Transport der Kohlenbrocken war anfangs ein Problem, aber findige POWs bastelten aus organisiertem Material Behelfsschlitten für die Kohlensäcke. Eines nachts wurden wir unsanft aus dem Schlaf geweckt und mußten uns zur Musterung vor unseren Kojen aufbauen. In Begleitung des englischen Lagerführers erschienen mehrere Polizisten und wir mußten die Hände, Handflächen nach oben, zur Kontrolle vorzeigen. Später erfuhren wir, daß in der Nähe des Lagers ein junges Mädchen bei einem Vergewaltigungsversuch überfallen worden war. Das Mädchen hatte sich gewehrt und den Mann in die Hand gebissen als er versuchte, sie am Schreien zu hindern. Durch die Kontrolle sollte festgestellt werden, ob der Täter ein deutscher Kriegsgefangener gewesen war. Das war nicht der Fall; der Täter, ein Engländer wurde ermittelt und der Bestrafung zugeführt.
Schon seint Ende 1946 hatte die Zahl der Kriegsgefangenen in unserem Hostel abgenommen. Die Glücklichen waren in ein Entlassungslager verlegt und dann über Hull nach Deutschland repatriiert worden. Ich war davon überzeugt, daß ich einer der Letzten sein würde, der das Lager verlassen würde, um nach Deutschland geschickt zu werden. Da meine Eltern sich in der Ostzone befanden, hätten sich meine Chancen auf eine Heimkehr weiter vermindert, wenn ich die Zone als Entlassungsziel angegeben hätte. Deswegen gab ich die Adresse eines Crewkameraden in Bremen als Entlassungsort an. Er hatte mir mitgeteilt, daß ich bei seinen Eltern und ihm jederzeit willkommen sei.
Aber noch war es nicht soweit. Mir ging es auch gar nicht so schlecht. Ich hatte meine Freundin, die mich in jeder Hinsicht verwöhnte, ein Fahrrad und genug Geld, um mir kleine Annehmlichkeiten zu leisten, und mußte keinen Hunger leiden. Das alles unterdrückte aber nicht den Wunsch, endlich wieder ein freier Mann zu sein, die Familie wiederzusehen und etwas für meine berufliche Zukunft zu tun. Und endlich schlug auch für mich die Stunde. Überraschend wurde mir mitgeteilt, daß ich mit zwanzig anderen Kameraden in ein Entlassungslager verlegt werden sollte. Ich konnte mich gerade noch einmal auf`s Fahrrad schwingen, um Rose auf Wiedersehen zu sagen. Sie hatte Tränen in den Augen, als ich mein Rad bestieg und die Straße hinauf nach Ferriby Sluice entschwand. Ich hatte ihr meine vorläufige Anschrift in Deutschland hinterlassen und wir sind noch lange brieflich in Verbindung geblieben; durch Päckchen hat sie mir die harte Zeit in Deutschland von 1947 erleichtert.
Zum x-ten Mal packten wir unsere Seesäcke, mein Fahrrad schenkte ich einem der Zurückbleibenden und dann ging die Fahrt im LKW ab zum Entlassungslager, das sich in der Nähe des Fischereihafens Grimsby befand. Als wir das Lager betraten dachten wir zuerst, daß wir uns in der Adresse geirrt hätten, denn aus den Lagerlautsprechern ertönten Ansagen in polnischer Sprache und die Campinsassen unterhielten sich ebenso in dieser Sprache. Es hatte aber alles seine Richtigkeit. Der Großteil des Lagers war ehemaligen Angehörigen der deutschen Wehrmacht vorbehalten, die aus Polen kamen und aufgrund der Volkslisten zu Deutschen gemacht wurden – oder sich machen ließen. Inzwischen hatten sie aber ihr polnisches Herz wiederentdeckt, um in ihre alte Heimat zurückkehren zu können. Sie sprachen auch kein Wort deutsch mit uns und wir sonderten uns schnell in unserer kleinen deutschen Abteilung von ihnen ab, erhielten sogar im Speisesaal abgetrennt von ihnen unser Essen. Es dauerte noch gute vier Wochen bis wir endlich diesem komischen Entlassungslager Lebewohl sagen konnten. In der Zwischenzeit versuchten wir der Langeweile und vor allem der Kälte Herr zu werden, denn es war eisig kalt in den Nissen-Hütten, und die Zuteilung von Brennmaterial war ein Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein. Wir hatten allerdings die polnisch ausgerichtete Lagerleitung in Verdacht, daß sie unsere Brennmaterialrationen zu ihren Gunsten verkleinerte. Da wir das Lager nicht verlassen durften, suchten wir im Lagergelände alles nur Brennbare für unsere Öfen. Schließlich wurden wir fündig. Die Fußwege innerhalb der Umzäunung waren mit Schlacke befestigt worden, und so gruben wir manchen Eimer Koksstütchen mit spitzen Stöckchen aus. Das Zeug brannte tadellos, und so hatten wir wenigstens an jedem Tag für einige Stunden eine einigermaßen warme Bude. Mit Schach und Kartenspielen wurden wir auch der Langeweile Herr, aber Ungeduld und die Ungewißheit, ob und wann wir endlich heimfahren würden, zehrte an unseren Nerven, und die Stimmung war bei allen gereizt. So wurde der eine oder andere, zu einem erneuten Verhör geholt, der mit betretener Miene wiederkam, seine Sachen packen mußte und wieder zurück in ein normales Gefangenenlager gebracht wurde, weil seine Angaben bei früheren Befragungen hinsichtlich seines Berufes und Wohnortes nicht den Tatsachen entsprochen hatten. Die Anzahl der Landwirte und Bauern unter den Gefangenen war aber auch wirklich erstaunlich, weil das bevorzugte Gruppen für die Repatriierung waren. Aber auch die längste Warterei ging einmal zuende und eines Tages im April 1946 war es dann endlich soweit. Wir packten unsere Seesäcke und fuhren, von bewaffneten Posten begleitet nach Hull. Wir waren wie erlöst, als wir die Planken eines Fährschiffes unter unseren Füßen spürten. Die drückende Enge wurde uns gar nicht bewußt, um nach Hause zu kommen hätten wir uns selbst wie Ölsardinen einpacken lassen. Endlich stachen wir in See und waren heilfroh, als wir nach dem Passieren von Spurn Head den Humber verließen und die offene Nordsee erreichten. Am nächsten Tag kam dann Land in Sicht und wir liefen in Cuxhaven ein. Es brach kein Jubel aus als unsere Fähre festmachte, es herrschte eher eine bedrückende Stimmung, denn was wir nach Jahren der Abwesenheit von Deutschland wiedersahen, war nicht dazu angetan uns optimistisch zu stimmen. Cuxhaven schien ein einziger Trümmerhaufen und wir fragten uns, wie es die Einwohner wohl fertigbrachten in diesen Trümmern zu überleben. Als wir anlegten, war uns auf dem Pier eine Anzahl jüngerer Frauen aufgefallen und wir dachten, sie seien zu unserer Begrüßung erschienen. Aber weit gefehlt nicht wir waren der Grund ihrer Anwesenheit, ihr Interesse galt einzig und allein unserer englischen Eskorte; uns würdigten sie keines Blickes. Unsere Reaktion: Beschimpfung der „Tommy Nutten“. So war unser erster Eindruck von der Heimat nicht gerade beeindruckend; wir sollten aber wenig später nach unserer Entlassung am eigenen Leibe spüren, daß es in dieser Zeit für jeden Einzelnen um das nackte Überleben ging und sich jeder selbst der Nächste war. Die vielgepriesene Volksgemeinschaft schien es nie gegeben zu haben, sie war nur Tünche gewesen. Ziemlich verstört saßen wir dann in einem Zug, der uns in das deutsche Entlassungslager in der Lüneburger Heide bringen sollte. Was wir aus den Fenstern des Zuges von Deutschland sahen, deprimierte uns sehr. Die deutschen Städte schienen alle dem Erdboden gleichgemacht, nur ab und zu sahen wir Bauernhäuser und Dörfer, die unversehrt geblieben waren. So erreichten wir schließlich Munsterlager, die letzte Stätte unserer Gefangenschaft. Wieder ging der alte Zauber los. Registrierung und Einweisung in Baracken. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die unterwürfige Haltung des deutschen Lagerpersonals den Engländern und ihrer Arroganz uns gegenüber. Damals war uns das aber egal, unser einziger Wunsch war es wieder freie Menschen zu sein. Ein Gerücht machte aber schnell die Runde. „Aufpassen, lasst die Klamotten nicht aus den Augen, hier klauen sie wie die Raben.“ So mancher, der unvorsichtig sein karges Gepäck aus den Augen gelassen hatte, sah es nie wieder. Nachts banden wir uns die Schuhe mit den Schnürsenkeln an den Händen fest, so daß sie uns nicht abhanden kommen konnten, und wir teilten in unserer Baracke eine Wache ein, damit unser Gepäck nicht plötzlich Beine bekam. Wie richtig diese Vorsichtsmaßnahme war, zeigte sich schon in der ersten Nacht. Unbekannte machten sich an den Barackentüren zu schaffen und drangen in unsere Baracke ein. Unsere mit Knüppeln ausgerüsteten Wachen machten aber diesem Spuk ein sehr schnelles Ende. In den Nächten bis zu unserer Entlassung blieben wir dann ungestört. Nach endlos erscheinenden Verwaltungsmaßnahmen war es dann endlich soweit. Meine Gruppe, die nach Bremen entlassen werden sollte, erhielt ein kärgliches Entlassungsgeld in Reichsmark und den so lang ersehnten Entlassungsschein aus der Kriegsgefangenschaft. Meiner lautete auf die Anschrift meines Freundes und Crewkameraden Jürgen Suhrkamp, Bremen, Wießenburger Straße, der mir ein Dach über dem Kopf angeboten hatte, da ich in die Ostzone zu meinen Eltern noch nicht entlassen worden wäre. So bestiegen wir nun, ein Häufchen von etwa 20 Mann, wieder einmal einen britischen LKW und fuhren unserem Entlassungsort Bremen entgegen. Alle meine Kameraden waren in Bremen beheimatet und fuhren zu ihren Familien, nur ich mußte mit der Fremde vorlieb nehmen. Ich wußte aber auch, daß mich Jürgens Eltern wie einen Sohn aufnehmen würden, bis ich die Gelegenheit finden würde, die Eltern in der Zone aufzusuchen. So ging eine Odysee, die vor viereinhalb Jahren in La Spezia begonnen hatte ihrem Ende entgegen. 19 Jahre alt war ich gewesen, als sie begann, und jetzt mit 23 ½ kehrte ich als Heimatloser wieder nach Deutschland zurück, in ein Land, das nach den Schrecken des Krieges um seine nackte Existenz kämpfte. Mir war aber vor der Zukunft nicht bange. Ich war jung und gesund und würde mir schon ein Leben aus dem Nichts aufbauen. So erreichten wir schließlich das zerstörte Bremen. Auf dem Bahnhofsvorplatz wurden wir von den britischen Soldaten aufgefordert, den LKW zu verlassen, und nach einem kurzen Abschied von den Kameraden stand ich ziemlich verloren da, schulterte meinen Seesack und machte mich auf zur Weißenburger Straße.
********************
Nachwort
Nach dem Krieg ging mein Großvater zur Polizei und 1956 zur Bundeswehr. Aufgrund der Tatsache, dass er während seiner Kriegsgefangenschaft sehr gut behandelt wurde, hatte er bis zu seinem Tod 2013 ein ausgesprochen starkes Faible für die Engländer.
Die in diesem Buch geschilderten Alpträume plagten ihn bis zu seinem Ende.
Den Tag seiner Rettung feierte er jedes Jahr als seinen 2. Geburtstag.
Aus privaten Unterlagen

Als Kadett 
Kadettenausbildung Marineschule Mürwik 
Fähnrich zur See
In La Spezia
Fotokopien aus einem englischen Buch, die eine Tochter von Frederick Robert William Flack meinem Großvater zugeschickt hat.

Ein Brief von Frederick Robert William Flack an meinen Großvater.

Blair Clay, Der U-Boot-Krieg, Die Gejagten 1942 - 1945 München: Willhelm Heyne Verlag, 1999, S. 268
Bilder von Kriegsgefangenen
Glückwünsche zum 21. Geburtstag
Ins Lager geschmuggelter Brief


Hannover 1949 als Polizist

1967: Nochmal in Kanada als Teilnehmer Canadian Army Staff College. Jetzt als Verbündeter

Kurz vor seiner Pensionierung als Oberst i.G. in Oslo, Norwegen

Mein Opa als Pensionär



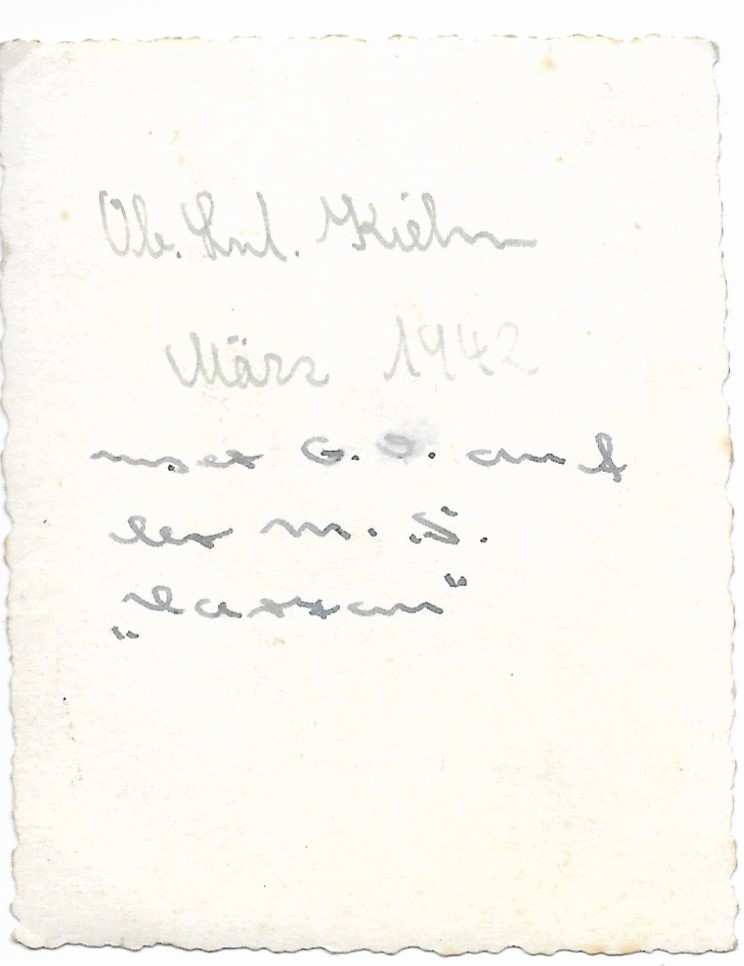
















Hallo,
mit Interesse habe ich die Geschichte Ihres Großvaters gelesen. Mein Großonkel war auch auf U 301. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Kontakt treten können.
Gruß
Andi Walter
LikeLike
Guten Morgen Herr Walter,
Sehr gerne. Mein Opa ist leider 2013 verstorben. Aber meine Oma lebt noch.
Ich würde mich sehr freuen, wieder von Ihnen zu hören. 🙂
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Köster
LikeLike
Ja, wunderbar. Meine E-Mail-Adresse lautet andi.walter@gmx.de . Ich freue mich schon, wenn wir uns kurzschließen. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Bilder. Vielleicht ist Ihr Großvater da drauf.
LikeLike
Sehr schön. Ich freue mich auch. Meine E-Mail Adresse lautet koestersebastian82@t-online.de Schicken Sie mir die Bilder gerne zu. Mein Opa ist zwar in La Spezia erst an Bord gekommen (er war damals 19 Jahre alt und gerade frisch gebackener Fähnrich geworden) aber vielleicht erkenne ich ihn ja auf den Fotos. Meine Oma ist jedenfalls auch ganz begeistert, dass Sie sich gemeldet haben. 🙂 Haben Sie Whatsapp? Vielleicht können wir ja auch darüber, parallel zur E-mail, Kontakt aufnehmen. Wie hieß Ihr Großonkel eigentlich?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Köster
LikeLike